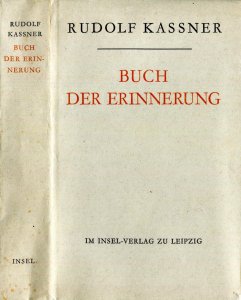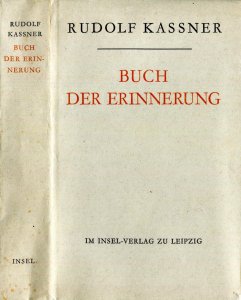RUDOLF KASSNER
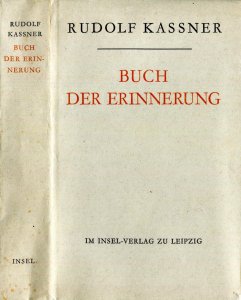 BUCH DER ERINNERUNG
1938
BUCH DER ERINNERUNG
1938
5. BEGEGNUNGEN
S. 259—293
259
BEGEGNUNGEN
Der Heilige von Benares
So erinnere ich
ihn. Es war in Benares, und zwar auf heiligstem, geweihtestem Boden in
jenem belebten Gebiete am rechten Gangesufer, welches eingekeilt ist
zwischen den Pilgerhäusern der einzelnen Hindu-Radjas,
geräumigen der reichen und mitten darunter unscheinbaren, alle
aber vor Alter schief geworden und aneinander angelehnt, wie um sich
gegenseitig zu stützen, und dem abgenutzten, uralten Stufen- und
Treppenwerk, das zum gewaltigen Strom herabführt. In diesem
Gebiete werden die Leichen derer verbrannt, welche den Wunsch und das
Glück hatten, in der heiligen Stadt zu sterben; hier haben de
Gurus, Priester, ihre Schirme aufgespannt und sitzen zu zweien
darunter, schwätzend, zankend von Schirm zu Schirm, indem sie auf
die Pilger warten, welche noch in den heiligen Legenden und
Gebräuchen belehrt werden sollen, bevor sie zum ersten Male in den
Fluten die vorgeschriebenen Waschungen mit dem braunen, jauchigen
Wasser vornehmen und dazu die entsprechenden Gebete sagen. Dort sah ich
ihn inmitten einer Auge und Sinn völlig verwirrenden Menschenmenge
von Einheimischen, Händlern, Hindus aus allen Teilen des riesigen
Reiches, braunen Tamilen aus dem Süden, aschblonden Kashmiris,
Nepalesen, Mahratten aus der Bombayprovinz, Menschen der Küste aus
dem orthodoxen Travankor, den an keiner der heiligen Stätten
fehlenden
260
langhaarigen
Fakiren, deren Stirn und Brust mit einer weißen,
kalkähnlichen Masse beschmiert ist, die Zugehörigkeit zum
Shiva- oder Wischnukultus verratend, Bettlern, Sannyasins im gelben
Mantel, Schlangenbändigern mit dem runden Korb aus Binsengeflecht
und der kleinen dunklen Flöte, dazwischen Kühe, junge Bullen,
Zebus, an den Menschen vorbei- oder diese beiseitestoßend zu den
Buden der Kaufleute hin, wo neben jeder für sie etwas grünes
Futter bereitstand.
Dort also sah ich ihn zuerst gehen: irgendwohin, schnell, achtlos. Ich
dachte an so ein Erdzeisel, das rasch über den Weg läuft auf
die andere Seite hin. Er wird nach einer Weile denselben Weg
zurückkommen durch die Menschen hindurch, ebenso schnell, achtlos
und unbeachtet. Das wußte man. Er war ganz nackt, ohne
Lendenschurz, ohne die weiße Brahmanenschnur, der braune
Körper noch gestrafft, faltenlos, in der Sonne leuchtend wie ein
herrlicher Krug, Kopf- und Barthaar wie Blätterwerk dem
natürlichen Wuchs folgend, ohne einen einzigen grauen Faden darin.
Er sei alt, sagte man mir, doch war das Alter weder zu erfahren noch
auszumachen. Es wurden mir sehr viele voneinander beträchtlich
abweichende Ziffern genannt. Die richtige war eben verloren gegangen
oder einfach nicht mehr da. Das ist immer so. Zahlen in Indien haben
wenig oder nichts mit Genauigkeit zu tun, sie sind wahrscheinlich nie
oder nur zufällig richtig und immer nur Ausdruck von etwas, darum
bald riesig groß, viel zu groß, bald winzig. Der Inder hat
nicht unsere einfache, vielleicht zu einfache Art, zwischen
Qualität und Quantität den Strich zu machen und davon
auszugehen. Wer das einmal eingesehen hat, wird vieles besser verstehen
und richtiger beurteilen. Auch den Heiligen, und warum und inwiefern
dieser in einer
261
Welt
der Kasten steht. Indien besitzt weder den Begriff und die Idee des
Einzelnen noch im Zusammenhang damit den der Masse, statt dessen aber
den Heiligen und die Kastenordnung. Gandhi hat darum nichts mit dem
Heiligen mehr zu tun, er ist ein Volksmann mehr als ein Mann aus dem
Volke, Mann der Tugend, häßlich, wie männer der Tugend
häßlich sind und häßlich sein dürfen,
häßlich wie Sokrates, der auch kein Heiliger, sondern ein
Mann der Tugend war. Heilige sind nicht häßlich. Man darf
das ruhig so sagen, es wird immer stimmen.
Eine der Wurzeln dieser höchst eigentümlichen, ganz und gar
unvergleichlichen Erscheinung des indischen Heiligen sehe ich eben
darin, daß der Inder anders, wie gesagt, zwischen Qualität
und Quantität, daß er ungezwungen üherhaupt nicht
dazwischen unterscheidet, daß Quantität durch
,Unrichtigkeit‘, durch Übertreibung nach der einen oder anderen
Seite hin Qualität wird. Weshalb auch alle Aussagen der Statistik
über den Inder, indisches Wesen und so weiter notwendig falsch
sein müssen, mehr noch als solche über andere Völker,
Staaten, etwa über die Bürger der Vereinigten Staaten von
Amerika, wobei ich an ein Buch wie Mother India von Katherine Mayo
denke, das ein solches Aufsehen in der Welt und Empörung in Indien
erregt hat.
Vielleicht wird die Menschheit einmal dahin kommen, daß die
Aussagen der Statistik über sie richtig seien, vielmehr das
Wesentliche treffen, dann dürfte auch jener Zustand erreicht sein,
da sich das Natürliche vom Grotesken nicht mehr unterscheiden
läßt und der Heilige, wie ihn Indien versteht, zum Inbegriff
des Unsinns oder der Sinnlosigkeit geworden sein wird. Noch aber lebt
er im höchsten und letzten Sinn gegen die Statistik und was damit
zusammenhängt.
262
Vielleicht
darf es auch so formuliert werden, daß der Inder das jeder
Statistik anhaftende Groteske eingezogen, geschluckt habe und nun in
sich berge und trage: als Heroismus, als Rhythmus, als ein
Unabsehbares, Grenzenloses, sinnloses Geborenwerden, sinnloses Sterben.
Es liegt eine höchst eindringliche Lehre in der Art, wie er
entschieden Quantität in Qualität zurücknimmt, wie er
jene in diese, wie er überhaupt umdeutet. Die Inder sind
zweifellos das größte Deutervolk, das radikalste; nach ihm
kommt erst der Chinese oder in Europa der Deutsche, und der Heilige
erscheint wie das Ende oder der Fruchtkern aller Deutungen. Genau als
das erscheint er, und das unterscheidet ihn auch so gründlich vom
christlichen Heiligen. Was hat er darum, was hat so ein Fruchtkern mit
den Mann der Tugend zu tun? Ohne den Heiligen vermöchten sie, de
Hindus, ebensowenig zu deuten, wie ein Mensch ohne Einheit zu
zählen und zu messen vermag. Darum kommt er immer wieder vor und
muß produziert werden, dieser Heilige.
Hört übrigens nicht jede Quantität als solche von selbst
auf, wenn wir einmal zu deuten anfangen? Ich finde, daß den
Menschen heute ein sehr starkes Verlangen nach Deutungen beseelt, und
ich führe es auf de Übermacht des Statistischen, des
Technischen und so weiter zurück. Nur wehren wir uns, wir Menschen
Europas, indem wir deuten. An einem Punkt soll, heißt das, alles
Deuten aufhören und einem Festen, soll der Tat weichen. Der Inder
ist auch in seinen Deutungen wehr- und endlos, und die
Verkörperung dieser seiner Wehr- und Endlosigkeit ist der Heilige.
Die Engländer als Beherrschende und darum genau zwischen
Qualität und Quantität Trennende behaupten, de Inder
lögen oder lögen leichter als wir. Auf alle Fälle
263
lügen
sie anders als wir: um sich nämlich gegen das Fremde, das Andere,
das um Gottes willen nur fremd und anders bleiben solle und gar nicht
einbezogen, einverleibt werden könne, abzugrenzen, gleichfalls um
des Ausdruckes willen. Die erwähnte Unterscheidung oder spannung
zwischen Qualität und Quantität ist zuletzt auf jene zwischen
Subjekt und Objekt zurückzuleiten. Der Inder hat nun einmal de
Neigung — ich lasse es jetzt bei diesem Ausdruck —, das Objekt als
solches zu tilgen. Daher seine enorme Humorlosigkeit. Don Quijote
würde in Indien nie einen Roman gehabt haben, sondern ein Heiliger
oder auch nur ein Fakir geworden sein. Ohne Sancho Pansa.
Und nur so läßt sich ferner der Glaube an die
Seelenwanderung einsehen, jenes Hinüberstürzen aus einem Leib
in den anderen, das schließlich nur in einer Welt statthaben kann
ohne Maß oder in einer solchen, darin alles Qualität
geworden ist oder wird, auch das Maß. Die Pilger zu den heiligen
Stätten oder Bergen oder um sie herum messen den Weg oder die
Wanderung, indem sie sich der Länge nach hinlegen und dorthin, wo
jetzt der Kopf liegt, die Ferse hintun und so fort bis zum Ende. Auch
sie messen statt mit dem Metermaß mit sich selbst, und wer so
mißt, der dürfte auch keine Schwierigkeit darin sehen,
daß er den eigenen Leib tausche mit dem eines höheren oder
niedrigeren Wesens. Ebenso wie er keine Schwierigkeit hat, das Objekt
zu tilgen, da sich das Maß nur aus der Spannung zwischen Subjekt
und Objekt zu bilden vermag.
Wie ohne bestimmbares Alter, so war der Heilige auch ohne Heim, Haus,
Hütte, Kammer und ohne das Haus oder die Kammer des Freundes,
sondern lebte in einem Schrein, in einer Kapelle, in seinem Schrein, in
seiner
264
Kapelle,
welche Kapelle oder welcher Schrein um weniges höher ist, als die
Länge des Rumpfes und des Hauptes zusammen betragen. Er
verläßt ihn und kehrt dahin zurück, vom Bade oder vom
Gang zu einer der umliegenden Kaufbuden kommend. Er lebt darin
lebendigen Leibes, gleich einem, der schon einmal gestorben war. Er
hockt darin oder ist darin aufgestellt wie bei uns und überall
sonst die Büsten, Statuetten, Gnadenbilder von heiligen
Männern oder Frauen, die einst gewandelt sind auf Erden. Hier aber
sind Diesseits und Jenseits offenbar nicht mehr voneinander geschieden
und ist der Damm eingerissen zwischen den beiden Reichen oder Lagen.
Wie vorhin zwischen Qualität und Quantität oder zwischen
Mensch und Ding.
Was ist nun, frage ich mich, damit für uns ausgesagt oder
bedeutet? Ein Ungeheures, muß die Antwort lauten, daß
nämlich das Zwischenreich, das eine, der Schönheit samt allem
Trost, allem Vor- und Aufschub, aller Vorwegnahme gefallen sei um
dieses Menschen willen, der atmend lebendigen Leibes zu Stunden im
Schrein hockt. Und ferner und daraus folgend, daß auch jenes dem
bloßen Begehren Unzugängliche, das Unberührbare der
Schönheit, daß deren strenge Satzungen, die auf unserem
Kontinent seit den Griechen für ausgemacht gelten und festgelegt
und vorweggenommen im menschlichen Geiste erscheinen, hier aufgehoben
sind um der Heiligung willen bei lebendigem Leibe.
Ist nicht der letzte Sinn allem Kunst der: Bannung des Dämons in
uns? Erst wer die Beziehung des Dämons in uns zur Idee wirklich
eingesehen, gefühlt und erkannt hat, weiß, warum wir die
Kunst haben oder warum der Schönheit ein Gesetzliches in uns
entspreche. Eine Welt aus bloßer Leidenschaft, ohne die Idee oder
ohne die
265
Einbildungskraft,
möchte einem offenen Krater gleichen und aufgerissen bleiben,
Opfer fordernd. Ich weiß kein ergiebigeres Thema für de
Meditation als dieses Zusammen und Ineinander von Leidenschaft und
Einbildungskraft, von Dämon und Idee. Und ich finde, daß
Idee überhaupt erst ein Gesicht erhält, wenn wir dazu den
Dämon in uns oder eine Welt des Dämonischen denken. Auch
möchte ich in der Kunst die Sanktion dieser Beziehung von
Dämon und Idee sehen. Aus welcher Beziehung sich allein das
Schwebende, das Doppelsinnige, allen großen Entscheidungen
Ausweichende des Kunstwerkes, kurz alles ergibt, was sich weder dem
bloßen Gefühl noch dem bloßen Intellekt eröffnen
kann.
Um bei dieser Gelegenheit das noch zu sagen, weil ich gerade in diesen
Tagen der Erinnerung durch die zufällige Lektüre einer sehr
kostbaren, von mir bisher immer überschlagenen Jugendschrift
Pascals: Discours sur les passions
de l’amour, darauf gestoßen bin. Der Franzose setzt an
Stelle von Idee oder Einbildungskraft l’esprit,
Geist. So heißt es im Discours
unter vielem ähnlichen: A
mesure que l’on a plus d’esprit, les passions sont plus grandes.
Oder: L’amour donne de l’esprit, et
il se soutient par l’esprit. Genau durch diesen ,Geist‘ und
dessen Beziehung zu den zwei Leidenschaften der Liebe und des
Ehrgeizes, auf welche Pascal ebenso wie Racine den Dämon in uns
reduziert, wird das Gebiet der Kunst über jenes der Gesellschaft
hinaus ausgedehnt, ausgezogen, die Kunst gesellschaftlicher und die
Gesellschaft kunstvoller, künstlicher. Was alles auf jene
schöne Mitte oder auch auf die Schönheit als Mitte
schließen läßt, welche dem französischen Volk
oder Wesen mehr eignet als etwa dem deutschen mit dessen
eingefleischtem Platonismus, Musik und Metaphysik. Es ließe sich
nebenbei mancherlei zum
266
Unplatonischen
des französischen Wesens sagen oder auch darüber, wie Plato,
wie der Platonismus das aufzulockern, aufzureißen gekommen sei,
was bisher Mitte gewesen war, und wie an Stelle der Mitte nun
Vermittlung oder der Eros als Vermittler gesetzt werden mußte.
In der Welt des Inders sind nun die Dämonen nicht durch die Idee
gebannt, welche Bannung der Kunst allein jene Position einer hohen
Vermittlung zu geben vermag, die sie in Europa inne hat, sondern sie
belagern als Idole oder Götzen den Rand und Saum der Welt oder
bilden den Umfang jenes Kreises, die Schale jener Frucht, deren Zentrum
und Kern eben der Heilige darstellt, lebendigen Leibes inmitten seines
Volkes im eigenen Schrein sitzend. Woher dann auch jene oft
hervorgehobene und vom Rationalismus gerügte Verbindung des
Zartesten und zugleich Erhabensten mit dem Eklen und Grauenerregenden
abzuleiten wäre.
Als ich seiner zum ersten Male ansichtig wurde, lief er, ich
wiederhole, schnell, achtlos und auch unbeachtet durch de Menschenmenge
hindurch. Da ich keinem Volke begegnet bin, inmitten keines geweilt
habe, das weniger neugierig oder auf das Fremde versessen wäre als
das indische, so will ich erst gar nicht anführen, wie wenig er
meiner achtete oder von meiner Anwesenheit unter lauter Hindus Notiz
nahm. Ich nehme an, daß er um etwas Mehl oder Butter ging zu
einem der zahlreichen Händler, die ihre Buden in unmittelbarer
Nähe aufgerichtet haben und es sich zur höchsten Ehre
rechnen, dem Heiligen das zu spenden, was er zur Erhaltung des baren
Lebens braucht. Als ich nämlich zurückkam zum Schrein,
saß er darin und knetete mit den Fingern Mehlkügelchen von
lichtester Weiße, sie in einer Reihe von drei oder vier vor sich
hinlegend. Bevor er sie nun in den Mund steckte, machte
267
er
mir, der ich mich neugierig vor ihm aufgepflanzt hatte, ein Zeichen mit
der Hand, daß ich wegsehe. Er gab das Zeichen, ohne sich im
mindesten dabei aufzuregen und darüber weiter Gedanken zu machen,
ob ich auch wüßte, worum es sich in diesem Augenblick
handle: beim Essen eines Hindu, schon gar eines Sadu, nicht zuzusehen.
Genau dasselbe Zeichen, nur böser, machte mir ein Jain-Asket in
Ahmedabad, jener Stadt im Westen Indiens, darin alle Tiere, die dort
leben: das indische Eichhörnchen vor allem, der stille, sehr
solitäre, gedankenvolle indische Star, die Affen, Sittiche,
Bussarde alle Scheu vor dem Menschen verloren haben, da es seit mehr
als zwei Jahrtausenden nicht vorgekommen sei, daß ein Mensch
einem Tiere dort etwas zuleide getan hätte. Es ist das jener Ort,
darin die eifrigsten Adepten des Jainismus mit einem kleinen Besen vor
sich den Weg kehren, damit ihr Fuß die Käfer am Boden nicht
zertrete. Der Jain-Asket saß aber statt in einem Schrein oder
einer Kapelle in einem veritablen Käfig mit starken eisernen
Gitterstäben und lebte darin genau so wie bei uns die
Raubvögel der Zoologischen Gärten oder in Jaipure, wohin ich
von Ahmedabad zunächst kam, die frisch eingefangenen Tiger oder
Leoparden im Park des Maharadschas, nur nährte er sich statt von
faulem oder frischem Fleisch von ebensolchen Mehlkügelchen wie der
Heilige am Ufer des Ganges. Der Jain will offenbar damit das Leiden des
Tieres auf sich nehmen, das Leiden und die Gitterung des Fleisches um
sich tun, er will sich dem Tier angleichen. Bestimmt will er das:
über alle Bildlichkeit und Metaphorik hinweg- und hinausgelangen,
kunstlos, ohne Vermittlung, Mitte sein, nicht sich spiegeln im anderen,
sondern hinüberspringen in ihn.
268
Ich
habe nie auf Erden, im wirklichen Leben selbst das, was ich
Identitätswelt nenne, so deutlich vor Augen gehabt und in der
Anschauung genossen wie dort im Jaintempel von Ahmedabad oder auch hier
vor dem Schrein des lebendigen Heiligenleibes, und ich frage mich jetzt
in Erinnerung daran, ob das Wesen dieser Identitätswelt nicht
darin liege, daß hier die Phantasie sich mit sich selbst aufhebe,
indem der Mensch versucht, das Objekt aufzuheben oder zu tilgen. Von
diesem Jain im Käfig darf man behaupten, daß er in einem
erhabenen Sinn gegen die Vernunft lebe oder, was das Wesen der Vernunft
besser ausdrückt, die Grenzen der Vernunft resolut und vor aller
Angesicht überschreite, wie einer einen Fluß
überschreitet, der die Grenze seines Landes bildet. Und was
besonders wichtig erscheinen darf: vor diesem nackten Menschen im
Tierkäfig konnte man einsehen, wie die Gesetze der menschlichen
Vernunft und der menschlichen Einbildungskraft ineinandergreifen und
wie gerade darin jene Kunst des Menschen wurzle, welche der Heilige
ignoriert.
Beide hatten mir darum das Zeichen gemacht wegzusehen, weil die
Nahrungsaufnahme für den Hindu ebenso mit Scham verbunden ist wie
der Geschlechtsakt oder die Verrichtung der Notdurft. In einem
bestimmten Sinne wird damit die uns geläufige Unterscheidung
zwischen Oben und Unten aufgehoben und der menschliche Körper, so
wie er ist, dem Gestirn oder dem Ei, dem Weltei Brahmas, angeglichen.
Ich will damit sagen, daß der Hindu keinen anderen Weg habe, in
einer Welt ohne die Scheidung von Bühne und Zuschauerraum, in
einer also wesentlich magischen und undramatischen, vielleicht
schreckensvollen, aber der Art nach nicht tragischen Welt, Charakter
und Schicksal eines werden zu
269
lassen,
als diesen, daß Körper und Gestirn, Körper und Ei sich,
wie ich wiederhole, gegenseitig angleichen oder daß der Leib
magisch werde. Wodurch zugleich die innigste und einzigste Vereinigung
von Körper, Seele und Geist, die absolute Einheit der Drei, die
Einheit des Welteis, ausgesprochen wird. Die unmittelbare Folge
für das sittliche Leben ist, daß an Stelle dessen, was wir
Charakter nennen, die Gesetze und Regeln der Kaste treten. Kaste als
solche wurzelt im magischen Leib des Heiligen.
Nichts im Geistes- und Seelenleben Europas kommt dieser besonderen
Beziehung des Heiligen, der an sich keiner Kaste mehr angehört und
aus jeder Kaste hervorgegangen sein kann, zu den Kasten gleich oder ist
ihr ähnlich. Und nichts vermag die Idee der Kaste so von Grund aus
zu fälschen wie gegebene oder mögliche soziale oder
humanitäre Bedenken seitens des Westens. Der reichste Mann in
Benares, um ein Beispiel anzuführen, wie der Hindu wertet, ist
jener Paria, der das Holz zur Verbrennung der Leichen verkauft. Wer
eine Leiche berührt, verunreinigt sich, und nur ein ganz und gar
Unreiner, welcher auch jene Möglichkeiten der Reinigung nicht
besitzt, wie sie dem Hindusohn gegeben sind, welcher seinen toten Vater
zu berühren gezwungen ist, nur der Paria darf das im übrigen
sehr teure Material zu jenen Scheiterhaufen liefern, auf welchen die
Leiber der frommen Hindus am Gangesufer Tag und Nacht seit
Jahrtausenden brennen und schwelen.
Eines ist nämlich dem Heiligen infolge der bedeuteten
Mittestellung (ohne die Unterscheidung von Oben und Unten) genommen:
das Revolutionäre. Der indische Heilige ist im Wesen ebensowenig
Revolutionär wie Mann der Tugend. Was ganz und gar schon in der
Idee des magischen Leibes enthalten ist, dessen der Mann der
270
Tugend
ermangelt und gänzlich ermangeln muß, so zwar, daß man
sich zuweilen verleitet fühlt zu sagen, dieser sei letztlich aus
einem Mangel an Magie hervorgegangen und somit gezwungen, das ganze
Leben lang als ein pis-aller
zu figurieren. So steht er auch, so steht der Revolutionär
außerhalb der Menge oder ihr gegenüber, während der
Heilige pure Mitte ist, Mittelpunkt eines heiligen Kreises, Fruchtkern.
Und genau aus dieser notwendig exzentrischen, gebärdenreichen
Position des Revolutionärs ergibt sich die besondere Wichtigkeit
dessen, was er sonst oder daneben sei, oder ob Glaube und Rede, Glaube
und Handlung bei ihm übereinstimmten. Das in einem tiefen Sinn
Beruhigende beim indischen Heiligen hingegen ist, daß er nichts
sonst oder nichts daneben sei, weshalb er auch nur aus einem Volk
geboren werden kann, welchem in einem für uns unfaßbaren
Grade die Neugier fehlt. Ja, man darf so weit gehen und behaupten,
Widersprüche bedeuten in seiner Existenz so wenig, daß er
durch nichts weniger in der Welt gefährdet oder kompromittiert
erscheint als durch den Schwindler oder Nachahmer, daß der
gewöhnliche Fakir der Straßen und Plätze, der Mann der
Tricks, zu ihm gehöre, daß dieser den Rand und Saum der Welt
des Heiligen ebenso bilde wie die Götzen oder Götzenbilder
den Rand und Saum der göttlichen Wesenheiten.
Indem nun der Heilige oder der magische Mensch — beides kann nicht nur
in Indien, sondern auch in ganz Asien nicht auseinandergehalten werden,
und zwar darum, weil die Begriffe Europas von Freiheit, Maß und
Geschichte fehlen — die Mitte eines Kreises oder auch das Endglied
einer Reihe bildet, ist er der Tat als solcher ebenso wie auch
jeglicher Bestimmung durch diese enthoben. Was ihn endgültig vom
Revolutionär im engsten und weite-
271
sten
Sinne trennt, welcher sich mit seiner Tat übertreffen oder
überholen muß, so daß die vollkommene Tat eben um
ihrer Vollkommenheit willen jedesmal im Opfer zu enden hat. Christus
ist darum im säkularen Sinn Revolutionär, in der Tat das
erhabenste Beispiel eines solchen, Buddha der berühmteste
Grenzfall des Heiligen und des Revolutionärs.
Frage: Was tut aber der Heilige, von dem hier die Rede ist, in seinem
Schrein trotz allem? Die bloße Tatsache, daß er in einem
Schrein sitzt statt in einem Haus oder Kloster, ist schon
gleichbedeutend damit, daß er eben der Tat im gewöhnlichen,
im menschlichen Sinn enthoben sei oder daß sein Tun der Spitze,
des Zieles ermangeln müsse, wenn schon von einem Tun die Rede sein
soll. Sein ,Tun‘, sein Werk, ist also dies: Unfruchtbare Frauen oder
solche, die sich noch ein Kind wünschen zu denen, die sie schon
besitzen, pilgern zu ihm von weither und berühren auf mannigfache,
in Worten nicht immer wiederzugebende Weise ihn an jenem durch Askese
der Erregung nicht mehr teilhaftigen Körperteil, darin das
Begehren des Mannes und die Kraft der Zeugung ihren engsten Raum oder
Durchgang findet. Das ,tut‘ also der Heilige: ein Tun, das zugleich
Leiden ist, und darum, zu diesem ,Zwecke‘ sitzt er in einem Schrein
statt in einem Haus oder Kloster. Die große Lehre daraus,
Ausdruck einer Identitätswelt so erhaben wie kein anderer, ist
die, daß Fruchtbarkeit und Entsagung einander bedingen oder
aneinander gebunden sind und daß der Damm zwischen Ja und Nein,
zwischen der Bejahung und der Verneinung eingerissen wurde und beides
nun frei und ungehalten ineinander überströme. Oder auch,
daß der gewaltige Strom von Zeugung und Geburt kein Bett
fände ohne die Tat oder das leidende
272
Tun
des Asketen. Das ist der tiefste und letzte Sinn der indischen Askese.
Ich habe in meinem Buch über die Einbildungskraft behauptet,
daß das asketische Ideal des 19. Jahrhunderts dort, wo es
durchbricht, aus dem Kritizismus der Wende vom 18. ins 19. Jahrhundert
herkomme, und dabei Schopenhauers und Leo Tolstois vornehmlich gedacht.
Alles hier und jetzt Vorgebrachte bestätigt und vertieft diese
meine Ansicht. Die indische Askese ist nicht kritisch im
europäischen Sinne, sondern magisch. Im magischen Sinn
überpersönlich. Weshalb auch die Götter und Dämonen
und nicht nur die Menschen Askese üben.
Als ich vor vielen Jahren am Grabe des heiligen
Sergius an der zweitberühmtesten Wallfahrtsstätte
Rußlands stand, im Troitza Monastyr bei Moskau, kamen und gingen
Pilger von überall her des großen Reiches, ganz alte
Männer und Frauen im Pilgerkostüm, Kopf und Gesicht gegen den
Sturm und Schnee und Staub der endlos langen Straßen, vielmehr
Wege über Felder, Steppen und durch Wälder, in Tücher
und Fetzen oder Felle eingefatscht, um der leichteren Fortbewegung
willen auch die Frauen in Hosen und hohen Stiefeln. Es kostete mich
Mühe, das Geschlecht zu unterscheiden, und es war im gegebenen
Falle auch nicht immer möglich. Da fiel mir jene Stelle eines
apokryphen Evangeliums ein, welche ungefähr so lautet, daß
das Ziel, Heil und Ende nicht eher kommen könne und werde, bis
nicht das Männliche weiblich und das Weibliche männlich
geworden wäre. Hier ist aus der Askese Pilgerung geworden, etwas
gleichfalls im größten Sinn Unkritisches.
Ich erzähle, um abzuschließen, noch das vom Heiligen, dessen
Name ich nicht weiß und von dem ich mir einbilden möchte,
daß er um der genannten Funktion willen
273
keinen
oder wenigstens keinen von Wichtigkeit besessen habe. Man sagte mir,
daß er seit Jahren — seit siebzehn, doch diese Ziffer wurde
vielleicht nur mir, dem neugierigen Europäer, mit etwas wie
boshafter Ironie geschenkt und war an sich völlig unwichtig — kein
Wort mehr gesprochen habe, daß er aber nachts, wenn das ganze
Stufenwerk zum Ganges hinunter menschenleer geworden sei und
drüben am linken, ebenen, öden Ufer die Schakale heulen, nach
angeschwemmten Leichenteilen suchend, daß er dann, im Flusse
stehend und die vorgeschriebenen Waschungen vornehmend, dumpfe Laute,
Schreie ausstoße und daß sich auf solche Weise die gestaute
Sprache Luft mache. Auch diesem an sich ganz natürlichen Vorgang
liegt jener schon bedeutete Sinn der Angleichung an die Kreatur
zugrunde. Auch das Wort ist wie alles Angeglichene, wie das Fleisch,
das der Seele, wie die Seele, die dem Geiste angeglichen, damit
identisch ist, auch das Wort ist magisch und kommt als ein Magisches
aus dem Urschrei (Om) und kann
nur als ein solches in diesen wieder zurückgenommen werden. Auch
das Wort ist hier nicht mehr Tat gleich dem Wort des Revolutionärs
und darum auch nicht durch die Begriffe, durch das ganze Begriffsnetz,
das Maschen- und Maßwerk der Begriffe, woran revolutionäre
Reden so heftig zu leiden pflegen, vom Ursprung und Urschrei geschieden.
Der Shivapriester
Kalkutta. Der Abend wie überall in den Ländern nahe dem
Äquator rasch in Nacht übergehend. Die Luft feucht,
ölig, braun. Menschenmassen auf den Plätzen der sehr
ausgedehnten Stadt sich sammelnd, in den Straßen drängend,
stauend, alles in Erwartung des Fest-
274
zuges
der Sarasvati, der Athene der Bengalen, wie mein sehr gelehrter
Gastfreund Chauduri auseinandersetzt. Dieser ist Richter am obersten
Gerichtshof in Kalkutta — damals noch der Kapitale Indiens —, der
Brahmanenkaste angehörig und einer der drei oder vier großen
Familien der Stadt entstammend wie die Boses und Tagores, religiös
freisinnig, zum Brahmasomaj sich bekennend, das man am besten als
Glaubensbekenntnis der Gebildeten und Aufgeklärten, als eine Art
metaphysisch unterbauten Rationalismus bezeichnen mag. Gestern beim
Abendessen in seinem Hause aßen die Frauen mit, und es wurde
unter anderem ostentativ altes Kuhfleisch serviert, das
möglicherweise nur Pferdefleisch war. Wir sitzen jetzt in seinem
schönen Landauer, dessen harrend, was sich unseren Blicken
darbieten werde. Das Fest findet alljährlich im Januar statt und
besteht darin, daß Bilder, Statuetten der Göttin, Puppen in
Seide, mit Steinen und Perlen besät und besteckt, oder
ungeschmückte, je nach den Lebensverhältnissen der Frommen,
auf Wagen, mächtigen, knarrenden, von vier Zebus gezogenen
Gestellen, auf denen die Familienglieder vom Großvater bis zum
Enkel, stehend oder sitzend, mitten um die Puppe herum Platz finden,
oder auch auf Wägelchen, Schubkarren durch die Straßen der
Stadt geführt werden. Den großen Wagen schreiten viele
Tänzerinnen mit Musik voran, den kleineren wenige oder keine.
Mitten unter allen fällt mir ein einzelner, Armer auf, der
tiefernst, ja ergriffen und in seiner Ergriffenheit selig seine Puppe
an einen Stecken gebunden vor sich her im Tanzschritt trägt, alle
Wagen und Karren im Laufe überholend. Der Zug geht zum Flusse
Hugli, in dessen Fluten die Puppen samt ihrem Schmuck, darunter sich
sicherlich auch mancher echte finden mag, geworfen werden und versinken.
275
Dieses
Schauspiels harren wir, von weitem dringen Musik und Menschenrufe,
Schreie zu uns her, die näher kommen und anwachsen, unser Wagen
wird schließlich von einem englischen Polizisten gezwungen, am
Straßenrand Halt zu machen, da brechen vor uns durch die gestaute
Menschenmasse hindurch Priester mit Fackeln und Gongs über die
Straße hinüber zum Standbild der Göttin Kali, das auf
einem weiten, leerstehenden, mit dünnem, welkem Gras bewachsenen
Baugrund errichtet ist. Alles geschieht sehr plötzlich,
unvermittelt, fast feindlich, ohne dessen auch nur im geringsten zu
achten, was jetzt die Gemüter vieler Tausender in andächtiger
Spannung hält. Indem einer von den Durchbrechenden, die Stufen zu
jener Göttin, durch welche der Mord und die Zeugungskraft zugleich
geheiligt sind, rasch emporspringend, mit der brennenden, rauchenden
Fackel Lichtkreise, viele, einen in den anderen im Schwunge verlaufend,
um die grinsende Götterfratze zieht, schlägt ein anderer den
Gong, daß es durch die Nacht gellt und mir Herz, Hirn und Gebein
erbeben. Alles das ist die Handlung weniger Augenblicke und muß
vollzogen werden, bevor der Festzug der Sarasvati vorübergeht,
welche gleichsam das andere Prinzip in der Mythologie der Bengalen, die
Lichtseite der göttlichen Allheit, verkörpert...
Mir fällt das Gesicht des Priesters mit der Fackel auf: vom Schein
der Flamme gerötet, wie trunken, bartlos, die Stirn bis nahe an
den Scheitel ausrasiert, das gefettete, langsträhnige Haar im
Nacken straff zu einem Knoten zusammengerafft, die Augen wie
heiße dunkle Steine. Die Gesichtszüge waren nicht die eines
Gefestigten, das sich zu behaupten weiß, sondern waren wie
verzogen, hatten das Verzogene eines zugleich Erbarmungslosen und
Geängstigten, den Eindrücken und dem Niederschlag im
276
Gesicht
eines Kranken nach quälenden Träumen gleichend. Im
Augenblicke sehe und fühle ich nur e i n e s
: die Qual und das Todeszucken der Ziegen, die täglich
vor den Altären der Göttin hier und überall in den
Tempeln, wo die Kali verehrt wird, geopfert werden, ist in das Gesicht
des Priesters, das blank und alterslos erscheint hinübergesprungen
und hat sich dort eingegraben.
Dieser Sprung nun hinüber von Gesicht zu Gesicht, dieser Tausch
der beiden Seelen ist vor sich gegangen, ist vorgenommen worden. Frage:
Wo? Innerhalb welches Bezirkes oder welcher Ordnung? Bezirk und Ordnung
allein entscheiden hier. Antwort: Unzweifelhaft in jener des
Dämonischen, darin Priester und Opfer zueinander streben,
nacheinander verlangen und von Anfang an zueinander gehören. Vor
der Entscheidung also zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und
Unrecht und vor allem jenem, was mit dieser Entscheidung ein für
allemal gegeben ist: Distanz, Charakter, Idee, Glaube, Geschichte. Wir
befinden uns hier in jenen Bezirken des Unterirdischen, wo nicht so
sehr Menschen geboren, wie Schicksale ausgelost werden, wo Bilder leben
und bestehen, wo Bilder allein hausen gleich den heiligen Schlangen in
Erdlöchern, in einer Welt also, darin sich Gut und Böse, Sinn
und Sinnlosigkeit vertragen oder ineinander verbissen sind. Noch
einmal: vor der Entscheidung und Wahl, vor dem daraus gewonnenen
Maß, vor der Größe, vor dem angeschauten und
schauenden Gesicht, denn ohne Maße kein Gesicht. In jenem Reich
nämlich, im angestammten der Schlange, darin, wie ich sage, Bilder
leben, unabziehbar, Bilder atmen, Bilder nichts verdecken oder
versprechen und vortäuschen, sondern s i n d,
ist noch kein Maß da und kann kein Maß den Dingen entnommen
werden. Wo leben so wie hier Bilder
277
sonst
noch? frage ich. Nirgends. Heute weiß ich es zum ersten Mal.
So viel im allgemeinen über das Reich, worin, ich wiederhole,
jener Sprung hinüber vom Gesicht des Opfers zu jenem des Opfernden
vor sich gegangen und der Tausch beider Seelen, der grausamen und der
geängstigten, vorgenommen worden ist.
Zweierlei aber ist mir dabei oder danach eingefallen und immer klarer
geworden: Erstens, daß die sogenannten Schicksalsmenschen, die
echten, und soweit sie es sind, wie Nietzsche und auf einem tieferen
Niveau Lenin, in diesem Reiche ganz und allein ihre Heimat haben und
somit ausschließlich der Ordnung des Dämonischen
angehören. Bei Lenin ist es zu offenbar, als daß
darüber noch viele Worte zu verlieren wären. Dort, wo er etwa
das Dämonische verläßt oder verlassen möchte,
müßte er unmittelbar ins Platte, ins schauerlich
Gewöhnliche reichen, darin auftauchen, wovon noch gehandelt werden
wird. Bei Nietzsche aber muß auffallen, daß sich bei kaum
einem anderen Geist das Falsche mit dem in bezug auf Kraft und
Schönheit Außerordentlichen so offensichtlich verbunden
habe. Gleich in seinem ersten Werke stimmt vielleicht nichts wirklich
und ist doch alles oder das meiste, wenn wir von dem über die Oper
Vorgebrachten absehen, wundervoll. Psychologische Erklärungen
interessieren mich nicht, Psychologie scheint mir immer mehr die
Wissenschaft vom Ewig-Unreifen, Sich-nie-Schließenden und darum
jeder Ordnung sich Entziehenden zu sein; mich geht hier und
überall nur die Ordnung an, in welche eine Erscheinung einzureihen
ist. Darum ist das Gleißende, die Verführung bei und in
Nietzsche immer echt. Zum Unterschied etwa von Plato, bei dem das
Gleißende oft nur falsche Metaphorik
278
oder
Poesie bedeutet und auch wegzulassen gewesen wäre.
Das andere, was der Anblick des Shivapriesters mit der Fackel in mir
auslöst, betrifft die Beziehung des Dämonischen zum
Gewohnten, ja Gewöhnlichen, zur täglichen Übung oder wie
man das sonst nennen will. Es ist so, wie wenn das Gewohnte,
Gewöhnliche, ja die Banalität selbst nicht mehr und nicht
weniger wäre als der Schaum des Dämonischen, der
abzuschöpfende, als die Lage, Kruste und Schicht darüber,
welche abgehoben, weggekratzt oder weggeräumt werden könne.
Nichts erscheint mir so falsch und platt wie von der Gewohnheit als der
zweiten Natur zu reden. Und von hier führt ein direkter Weg zu
dem, was mich oft im Geiste beschäftigt und welchem ich auf
mannigfache Art und Weise Ausdruck zu verleihen versucht habe: zum
Verhältnis des Dämonischen, genauer: des
Dämonisch-Magischen zur Nachahmung und weiter zur Grimasse, zur
Maske. Die Dämonen tragen Masken oder kommen verkleidet, nicht um
im menschlichen Sinn zu lügen, sondern darum, weil die Maske ihr
Gesicht, die Verwandlung ihr Körper und die Verzerrung der einzige
Ausdruck ist, worüber sie verfügen. Wenn wir eine
dämonisch-magische Welt annehmen, darin unsere Leidenschaften
neben- und miteinander hausen wie Tiere in Käfigen, und sie von
der Natur als solcher, von der Welt der Ursprünge und des ewig
sich aus sich selbst Erneuernden trennen, so ist die Haut und Figur
dieser Welt, deren Gesicht: Nachahmung. Oder indem wir das
Räumliche ins Zeitliche übertragen: Wiederholung. Und in
diesem einzigen und tiefsten Sinne wäre dann alles, was und soweit
es den Gesetzen der Nachahmung (und Wiederholung) unterliegt: die Mode
also, jede Art von Etikette, Formeln der Höflich-
279
keit,
Vorschriften der Kaste, über dem Grund und Abgrund einer
dämonisch-magischen Welt aufgebaut und muß von der Kunst als
solcher unterschieden werden, die, wie ich andernorts darzutun versucht
habe, zwischen dem Dämon und der Idee vermittelt.
Die Höflichkeit, die Etikette, bis zu einem gewissen Grade auch
die Sitte, ist nur dort wirklich tief oder dringt durch die Haut durch,
wo unsere Idee von der Natur, vom Natürlich-Ursprünglichen
unbekannt ist. Bei den Chinesen, auf alle Fälle bei den Mongolen
mehr als bei den Ariern, in Asien mehr als in Europa, was übrigens
auch der Grund ist, warum sich Kunst und Kunsthandwerk in Asien, bei
allen magischen Völkern nicht so strenge trennen lassen wie in
Europa mit dessen Ideen von der Freiheit, der Natur, der
Persönlichkeit. Ich kann das hier nicht so ausführen, wie ich
möchte, nicht darlegen, warum etwa noch im Mittelalter Kunst und
Handwerk miteinander verbunden waren und die Trennung gründlich
erst durch den Idealismus des endenden 18. Jahrhunderts vollzogen
wurde. Die magisch-dämonische Welt hat an Stelle des Einzelnen und
von dessen Imperativen — der berühmte kategorische Imperativ Kants
ist der äußerste Protest gegen alles Magisch-Dämonische
und nur von daher gesehen ganz sinnerfüllt — die Welt der Kasten,
des Ranges mit dem Anführer der Horde, dem Kaiser als Sohn des
Himmels, dem indischen Heiligen bis zum Fakir und Gaukler herunter. Nur
der Natur gegenüber oder im Gegensatz zu dieser gibt es Freiheit.
Im Bereiche des Magisch-Dämonischen steht an Stelle der Freiheit
Erlösung. In Richard Wagners Werk ist beides verwechselt oder
durcheinandergeworfen, was sich freilich auch aus dem Wesen der Musik
ergeben muß, welche das Grenzgebiet des Magischen und des Na-
280
türlichen
beherrscht und erwachen mußte, nein, selbstherrlich werden konnte
in jenem Zeitpunkt, da Magie und Natur sich zu trennen anschickten, was
mit dem Aufkommen des eben signalisierten Idealismus, der Scheidung von
Kunst und Kunsthandwerk zusammentrifft.
Das Thema, das ich damit berühre, ist unerschöpflich, weshalb
man immer wieder darauf zurückzukommen sich veranlaßt
fühlt. Der Antike zum Beispiel fehlte durchaus die Idee einer
Selbstherrlichkeit, Selbständigkeit der Musik, weil (wenn das noch
ein weil ist) Natur noch ganz
eingebettet lag im Dämonisch-Magischen und somit die Idee der
Freiheit nicht aufkommen konnte. Ich führe darauf auch die
Tatsache zurück, daß jenes allem Antiken angeborene
Große im Schweren und Langweiligen enden mußte und geendet
hat. So war zuletzt das Große, die Größe Roms vom
Schweren und Langweiligen unzertrennbar und ist darum zerschlagen
worden und mußte zerschlagen werden. Wozu haben wir die Idee der
Freiheit, jene Idee aller Ideen, wozu anders, als um
hinüberzukommen, auch in der Zeit! Alles, was zugrunde geht, geht
an der Unfreiheit zugrunde.
Noch das zum Schluß, zumal da es uns wieder zu unserem Priester
der Göttin Kali, der Gattin Shivas, zurückbringt.
Verhält sich nicht das Dämonisch-Magische zum
Natürlichen wie das Momentane zum Zeitlichen? Die Dämonen
unterliegen dem Momentanen, nicht dem Zeitlichen. Dem Momentanen
entspricht die Maske, dem Zeitlichen das Gesicht der Menschen. Wenn
Ehegatten durch langes Zusammenleben, mit der Zeit also, einander
ähnlich werden oder Schafhirtinnen etwas vom Ausdruck der Schafe
bekommen, welche sie hüten, so ist es, als seien wir aus dem
Gebiet des Dämonisch-Magischen herausgeraten in jenes der Natur
oder auch zwischen beiden
281
stecken-
oder hängengeblieben. In jedem Falle aber darf und muß es
mit dem Shivapriester und dessen Angleichung an das Todeszucken der
geschlachteten Opferziegen, an diesen Ausgleich von Wollust und Angst
im Gesicht, dem Ausgleich in unseren Träumen zusammengedacht
werden.
Der Bettler von Lautschin
Carl Burckhardt gewidmet
Der Knabe mochte seine Stirn nicht. Das wäre ja gar keine richtige
Stirn, sondern etwas dazwischen, zwischen Haaransatz und Brauen,
zwischen Schädel und Gesicht, gar nichts Besonderes, das höbe
sich nicht ab und sei zudem da und dort an den Schläfen und wo man
nur wolle, mit einer Menge weißblonder Härchen besät,
als sollte daraus einmal ein Fell werden. Auch krampfe sie sich bei der
allergeringsten Gemütsbewegung in viele Falten zusammen, genau so
wie bei den Affen in Schönbrunn, wohin der Knabe einmal
geführt worden war. Sein Bruder, ja der habe eine Stirn, wie sie
sein soll, eine Stirn, die Stirn ist, und nicht eine Angelegenheit, die
man sich erst zusammenklauben müsse, eine faltenlose Stirn mit
einem klaren Haaransatz und nichts so Trübes. Und diesem
Untrüben, Offenen der Bruderstirn entspreche auch eine ganz
unverkennbare Distinktion und Reife des Ganzen, eine größere
Unbefangenheit, Freiheit. Mehr Glück. Und zwar dieses nicht so
sehr als Gelegenheit oder als eine Reihe erfreulicher Zufälle,
sondern als die Tatsache, daß sich bei ihm, beim Menschen alles
leichter löst und voneinander abhebt, daß nicht eines am
anderen zerre und reiße oder eines das andere trübe.
Knaben empfinden die magische Gewalt der Worte lange, bevor sie die
Fähigkeit erlangen, deren begriffliche Be-
282
deutung
zu fassen oder darauf Wert zu legen. In der Knabenwelt sind Wort und
Ding nicht voneinander geschieden, sondern durchdringen sich
gegenseitig. Man möchte sich so ausdrücken, daß das
eine das andere durchlasse oder daß das eine für das andere
dastehe. Alles Böse, alles Feindliche und Schlechte war für
den Knaben trübe oder lag im Trüben, im Unlichten. Darauf kam
es an, das war zu spüren: das Trübe. Geschah es zuweilen
nicht so, daß er absichtlich mit dem Fuß in eine
Straßenpfütze trat oder diese mit einem Stecken
aufrührte, nur damit auf solche Weise einmal der Spiegel
getrübt würde, worin der Himmel, die Wolken, der Ast eines
Baumes, die weiße Wand eines Hauses aufgefangen dalägen?
Warum? Um des Trüben willen, damit das Trübe sich wieder
einmal dem Blicke biete und diesen festhalte oder auch, damit darin
für den Augenblick alles Trübe, die Trübnis der
sinnenden Seele gebannt bleibe und auf solche Weise sich von ihm selber
löse, ihn selber lasse. Und dann wartete er und sah zu, bis der
Spiegel sich wiederum klärte und Himmel, Wolken, Bäume und
alles darin von neuem Einlaß fände. Oder es geschah,
daß er einfach weglief, nachdem er das Gewölk der
Trübnis aufgerührt ... Wissend, nicht wissend leben Knaben in
einer magischen Welt, deren Grenzen weiter reichen, als Stimmungen,
Spiele oder Märchen die staunende Seele zu weisen
wüßten.
Er hatte auch die Vorstellung, daß ein Menschenwesen mit einer
Stirn, wie sein Bruder sie hatte: wohlgerundet, bogig, gelöst,
licht, keinen Anlauf zu nehmen brauche, daß alles oder zum
mindesten sehr vieles ihm direkt angeboten werde und zuletzt einfach
wie von selbst dagewesen sei. Auch daß einer dann stets ein wenig
schwindeln könne, ohne zu mißfallen und aus der Bahn zu
geraten. Was liege schließlich schon am Schwindeln! Man
283
selbst
dürfe nicht schwindeln, das ist alles. Aber für den
Nächsten, den Bruder sei es mehr eine Frage des Glückes als
etwas anderes. Auch hier war die magische Vorstellung entscheidend und
hatte den Vorrang vor allen solchen, die Recht und Unrecht betreffen,
vor solchen, welche begriffliche Scheidung heischen.
Indem sich das Magische der Kindheit und des Knabenalters später
in ein Physiognomisch-Sinndeutendes allmählich wandelt,
drückt der zum Mann gewordene Knabe ein Ähnliches und
Verwandtes so aus: daß er — zum Unterschied von den anderen, die
wie zum Gebrauch immer da waren — gar nicht mit der Stirn, die ihm
einst so trübe und kummervoll-faltig wie die der Affen erschienen,
sondern mit dem Hinterkopf denke, mit dem Nacken, der zu allem dazu
sehr jung, knabenhaft jung, bäurisch-eigensinnig und auf die
allerunschuldigste Art hinterhältig erscheine, und daß er
darum nur im Anlauf, stürmend zu denken vermöchte, gleichwie
die Schwalben im Fliegen ihre Nahrung erhaschen. Aus welchem Grunde
auch Denken und Sehen bei ihm ein und denselben Akt bedeuten. Das
Denken vorn mit der Stirn, der bogigen, hingegen habe seine bestimmte
Beziehung zum Ohr oder brauche das Ohr, wenn sich Gestalt bilden und
eine Welt formen soll. In Hinblick auf welche Welt auch ein
Zusammenhang zwischen Logik und Musik leicht auffindbar sei, auch
zwischen System und Tanz. Aus dem Auge aber, vom Auge her komme das
Drama. Was aber beides vereinige und zusammenbinde: Ohr und Auge,
Ohrwelt und Augenwelt, System und Drama, Musik und Drama, das finde
sich wieder in der großen Spannung zwischen Himmel und Erde.
Dahinein dann wiederum die Spannungen zwischen den Himmelsgegenden:
Nord und Süd, Ost und West, münden oder daraus sie
entspringen.
284
Daran,
schloß er weiter, doch so, daß dieser Akt des
Schließens ganz und gar einen Akt des Lebens selbst in sich barg,
daran also, an dieser Einheit von Denken und Sehen, müsse es wohl
liegen, daß er, daß der Mensch über sein eigenes
Gesicht stets entweder hinausströme oder hinter dessen Grenzen,
Wänden und Ufern zurückbleibe, und daß sich ferner sehr
genau daraus, aus Über- und aus Ohnmacht, aus dem Wechsel von
Sturm und Flucht der Spiegel bilde, darin das Menschengesicht vor sich
selber auftauche. Und mit dieser Vorstellung möchte dann jene
andere abergläubische zusammengehen, gemäß welcher ein
Mensch, wenn er es über sich brächte, Tag und Nacht nicht vom
Spiegel zu weichen oder deutlicher: sein Gesicht auch nicht für
den Augenblick eines Augenblickes aus dem Spiegel vor sich
herauszunehmen, nicht altern könnte, ja über die Zeiten
hinweg fortleben müßte. Doch ist der Mensch seiner ganzen
Anlage nach dazu so unvermögend, daß er in Wahrheit, statt
also im Anblick seiner selbst ewig zu verweilen, mit Todesangst sein
Gesicht vom Spiegel weg-, aus ihm herausreißen wird, um es einmal
ganz fest ins Innere seiner beiden Hände zu drükken und dort
eine Weile zu bergen. Darin es dann nicht anders erstarrt sein
müßte als in einer Totenmaske.
Ich gedenke dessen jetzt, den ich den Bettler von Lautschin nenne. Der
war nämlich ein Mensch ohne Spiegel, so wie ich im Leben keinem
anderen begegnet bin. Das war er in der Tat. Auch kann ich mir ihn
nicht vorstellen, wie er je hätte sein Gesicht in die beiden
Hände drücken können und darin bergen wollen, denn der
Blick seiner Augen stach und stieß mit großer
Entschlossenheit, mit Kühnheit vor sich hin und von sich weg in
die Luft und das Licht der Erde. Man wußte nur nicht, zu was
allem dieser Blick sich entschließen möchte, denn er ging ge-
285
radeaus
weiter, ging ins Unwirkliche, in ein uns Ungewohntes und Unheimliches.
Es lag auch Bosheit darin, doch löste diese sich im Blick wieder
auf, wie sich der Rauch der Schornsteine in der blauen Luft eines
sonnigen Tages auflöst. Auch im Himmel, denke ich mir, wird er als
Bettler und nicht anders unter den Seligen weilen als in Lumpen, die
einmal ein Rock waren, den er geschenkt erhielt, den Krückstock
vor sich hinstoßend. Der andere, der alltäglich mit ihm
angehinkt kam um die Mittagsstunde, sobald die Glocke vom Kirchturm des
Schloßhofes ertönte, und den Gruß und alle
mögliche Rede, Wünsche und Segensformeln enthaltend, in ein
höchst unmelodisches, heiseres Brummen mischte, so daß es
genau so klang, wie in meinen Kindheitstagen das Brummen der bosnischen
Tanzbären, die am Nasenring gezogen von Dorf zu Dorf durch die
Landschaft tappen und, indem ihnen ein Stück Brot vorgehalten
wurde, zum dumpfen Tamburin in der schüttelnden Hand eines
fremden, von weither kommenden Mannes im roten Fez vor den Häusern
der Menschen tanzen mußten, Staunen, Entzücken und Angst dem
Kinderherzen einflößend, jener andere also, meine ich, wird
einmal den Bettlermantel und Stab abgeworfen, das Bettlerbrummen und
den Bettlergestank verloren haben und als ein lichter Geist unter den
Strahlenden einherwandeln. Sie kamen beide zusammen, einer hinter dem
anderen, nie nebeneinander. Es würde ganz unentsprechend,
gewissermaßen unnatürlich gewesen sein, wenn einer neben dem
anderen kameradschaftlich dahergekommen wäre und sie Reden
getauscht hätten. Nein, nein, so würde das nicht hinzunehmen
gewesen, sondern es mußte so sein, wie es war, daß einer
dem anderen folgte höchst ungleichen und zackigen Schrittes.
286
Wenn
ich nach stundenlangen Streifzügen in den ausgedehnten
Wäldern um die Mittagsstunde eines heißen Augusttages in den
Schloßhof zurückkam, fand ich das große Haustor meist
verschlossen, die schwere Kette vorgelegt und mußte durch eine
Seitentür hindurch, die in einen Raum führte, der als
Putzkammer galt. Hier saßen nun schon die beiden Bettler an einem
Tisch, einer neben dem anderen, jeder einen gefüllten Teller vor
sich. Der bosnische Tanzbär unterbrach sein Kauen und Schmatzen
mit erneuter Klage und erneutem Brummen, besser: vermengte im
Augenblick, da er meiner ansichtig wurde, das Kauen und Schmatzen
damit; der andere aber, der wahre, der Bettler aller Bettler, der sah
mich wohl, starrte in der Richtung zu mir hin und sah mich wiederum
nicht oder sah durch mich hindurch mit einem vom Essen entzündeten
Blick, er sprach auch kein Wort des Grußes, sondern es war so,
wie wenn er eben dabei wäre, sein Böses im Guten, im Seligen
der mittägigen Sättigung aufzulösen und gänzlich zu
tilgen. Wer aß noch so außer ihm? Niemand aß so. Es
war nichts von Gier oder Hast dabei, keine Verunreinigung. Er aß
ganz trocken, die Zähne bissen genau und nett ins Fleisch und in
das, was sonst noch auf dem Teller lag, hinein. Alle seine Sinne, auch
sein Ohr waren dabei. Doch das drückt noch nicht ganz aus, was ich
meine. Sagen wir einmal ganz kühn so: er aß das Eigene, wir
essen das Fremde. Er tat das Gehörige und brachte das Eigene zum
Eigenen. So essen nicht Menschen, so essen Geister, Dämonen, so
essen Verwandelte. Dieser Bettler, dachte ich mir, während ich
schnell am Tisch vorbeiging, um so bald wie möglich aus der
Putzkammer draußen zu sein, ist kein Bettler, sondern ein Geist,
ein Dämon, der sich in einen Bettler verwandelt hat. Es ist nicht
von Wichtigkeit, darüber nachzudenken,
287
wo
er in Wirklichkeit zu Hause, in welchem der vielen Reiche, die das
Weltall faßt, oder wer und wie er in Wirklichkeit sei. Denn wer
ist so da und so gegenwärtig wie ein Verwandelter? Seitdem ich ihm
begegnet bin, weiß ich es, denke es, daß ich einen
Verwandelten gesehen habe — will sagen: einen, der um der Verwandlung
willen keinen Spiegel braucht. Wunder und Geheimnis! Und aus diesem
Geheimnis allein und aus nichts anderem konnte er die Kühnheit
seines Blickes gewinnen, der ohne Ziel von ihm wegging, sinnlos um eben
des Geheimnisses und Wunders willen. Es scheint mir auch ganz
unmöglich, daß unser beider Blicke sich hätten kreuzen
oder mischen können, denn das gehört zum Verwandelten und
somit auch zum Menschen, daß deren beider Blicke sich nicht
kreuzen oder mischen oder sonstwie vereinigen könnten, weil beide
ein und dasselbe Ziel hätten. Und ebensowenig wie Blicke, schien
mir, hätten wir Worte tauschen können...
Mir wurde einmal erzählt von einem, der in Peking am Mahl eines
reichen Chinesen teilgenommen, daß die Enten, die unter vielen
anderen Gerichten gereicht wurden, darum so köstlich schmeckten
wie nirgendwo sonst, weil sie nicht wie bei uns zuerst geschlachtet und
dann gerupft, sondern weil sie zuerst bei lebendigem Leibe ihrer Federn
beraubt und dann nicht geschlachtet, sondern erstickt wurden, und zwar
damit, daß eine Gelatineschicht um den noch lebenden
Entenkörper gelegt wurde. So blieb aller Saft, aller Geschmack,
alles Köstliche in der Ente zurück und ging nichts verloren
auf allen den falschen Wegen, darauf wir uns mit den Enten, die wir
töten und essen, irgendwie zu vergleichen suchen. Seitdem ich das
gehört habe, denke ich stets beides zusammen: diese Art der
Entenzubereitung und den Bettler von Lautschin, den
288
Verwandelten.
Heißt, frage ich, Verwandlung zuletzt nicht auch das, daß
nichts verloren gehe, daß alles zusammen und beieinander bleibe
und auf solche Weise sich rette vor der Zerstreuung? Was geht nicht
alles verloren und wird zerstreut auf dem Wege, der von uns in den
Spiegel führt!
Der große Schauspieler
Er ist, um das Allgemeine über ihn auf der Stelle zu sagen, der
Gegenspieler zum Mann des Opfers, er, der große Schauspieler, der
große Cabotin, wofür ihn die Böswilligen halten, dessen
Gesicht Tausende und Tausende von Menschen aller Stände und
Klassen von der Bühne her, aus dem Film kennen und
allwöchentlich in Wochenschriften wiederfinden, so daß sie
es in jedem Augenblick mit Leichtigkeit aus dem Gedächtnis zu
reproduzieren vermöchten. Wer ihm aber auf der Straße oder
im Restaurant oder sonstwo außerhalb der Bühne begegnet,
sagt zu sich selbst oder seinem Begleiter: Das ist ***, und zu Hause
angekommen, erzählt er seiner Frau oder den Kindern: Ich bin ***
begegnet, und setzt etwas hinzu, was ihm in Bezug auf *** wichtig
erscheint. Oft setzt er auch nichts hinzu und freut sich im stillen.
Auch mir ist es heute mittag widerfahren, daß ich auf ihn
stieß. Vor dem Hause, darin er ein Stockwerk oder vielleicht auch
nur einen Flügel bewohnt. Ein Auto stand vor dem Haustor, und es
war klar, daß beide zueinander gehörten; mit einem Blick
mußte einer das weghaben, wer in solchen Sachen, Mensch und Auto
betreffend, mitreden will. Er hielt einen allerliebsten, noch sehr
jungen Dackel an der Leine, dessen langhaariges Fell feucht
glänzte gleich dem einer Fischotter. Offenbar handelt es sich hier
um ein sehr kostbares teures Tier von seltener
289
Zucht,
denn ich wenigstens bin bisher noch keinem ähnlichen begegnet.
Doch bleibt immerhin anzunehmen, daß andere Genaueres, ja das
ganz Bestimmte darüber wissen und der Dackel gelegentlich auch
mitphotographiert worden ist. Obwohl wir noch im Herbst staken und
wirkliche Kälte nicht zu spüren war, hatte der große
Schauspieler seinen Stadtpelz an, einen noch sehr neuen mit
mächtig ausladendem Biberkragen, feucht schimmernd ein wenig wie
das Fell des Dackels. Es war in der Tat ein schöner, ein nobler
Pelz; er strömte Wärme aus, Behaglichkeit,
Überfluß, Kummerlosigkeit, und zwar so sehr, daß einer
sogar den Besitzer desselben, dessen Berühmtheit und
persönliche Gegenwart, für einen Augenblick wenigstens,
darüber vergessen konnte. Alles andere erschien daneben — den
Dackel ausgenommen — unbeträchtlich: das abgetragene kleine weiche
Hütlein oben war direkt lächerlich, freilich so, als sollte
es sich jetzt eben durch sein Lächerliches daneben oder
darüber, über dem Pelz, behaupten; die Schuhe unten
zählten überhaupt nicht mit, sie sind wohl neu, dafür
aber fertig gekauft. Vielleicht wurde erwartet, daß man sie nicht
beachte, gar nicht bis auf sie komme. Was kann schließlich neben
so einem Pelz bestehen? Nichts kann bestehen. Nichts außer dem
berühmten Gesicht, das aber, wenn man genauer hinsieht, heute
wenigstens den vielen Photographieen, die wir davon kennen und im
Gedächtnis bewahren, gar nicht recht entsprechen will. Es steckt
jetzt, vielleicht auch immer etwas darin, was so ein Photograph wohl
leicht und bereitwillig wegretuschiert, was aber damit nicht aus der
Welt geschafft ist: ein Rest von Ärger. Ist es das? Oder
Schlaflosigkeit. Sind es die Spuren von Schlafmitteln? Oder ist es
einfach nur Leere? Will sagen: das, was übrig bleibt, wenn die
vielen Gesichter,
290
Heiterkeiten,
tragischen Ausbrüche der Rollen, eines nach dem anderen, davon
abgehoben sind wie Deckel von Schüsseln? Es ist nicht das Eitle,
sondern die untere oder rückwärtige Seite, das Hintere des
Eitlen. Etwas ganz ohne Glanz, etwas, das verzogen ist, überspannt
oder besser: vom ewigen Sichüberspannen zurückbleibt, etwas
gar nicht Gutes, woran wir keineswegs teilnehmen möchten. O Gott
nein. Das ist es also, und alles das steckt in dem schönen, neuen
Pelz, der sich selbst so ganz ohne Ärger, ohne Enttäuschung
gibt und, wie gesagt, Fülle atmet und Kummerlosigkeit. Es scheint,
daß da kein Ausgleich möglich ist und alles eben ertragen
werden muß.
Der große Schauspieler wartet offenbar auf etwas, der schnell
Vorbeigehende weiß nicht, wie lange, aber schon ist es da, worauf
er wartet: die Gattin, das Töchterchen an der Hand führend,
das seinerseits eine Puppe trägt. Wie ist das Gesicht der Frau mit
dem gütigsten, offensten Lachen überzogen, wie damit
angefüllt, wie hat sich darin alles in das Lachen verwandelt, das
nur für ihn da ist mit allem, was es enthält: Güte,
Hingegebenheit, Treue, Mitleiden, Ermutigung! Das Töchterchen
läßt die Hand der Mutter los und stürmt auf den Vater
zu, sich samt der Puppe in dessen Schoß, vielmehr Pelz
drückend. Auch der kostbare Dackel mit dem Fischotterfell, dessen
ganze Aufmerksamkeit bisher von den Vorgängen auf der belebten
Straße in Anspruch genommen war, wendet sich jetzt um, blickt
seinem Herrn ins Gesicht und wedelt mit dem Schweif. Der große
Schauspieler macht wohl einen Versuch, ganz allgemein gesprochen, etwas
von der vielen und großen Freude, die ihm hier entgegengebracht
wird, zurückzuerstatten, um nicht alles gleich wieder schuldig zu
bleiben, doch fällt es ihm schwer, sich
291
zu
wandeln, es fällt ihm jetzt, in diesem Augenblick, es fällt
ihm noch schwer. Wie soll er es aber verbergen,
daß es ihm gerade jetzt schwer fällt? Gut, daß das
Auto da ist, alle aufzunehmen bereit, jedem seinen Platz anweisend, dem
großen Schauspieler am Volant den Führersitz.
Zuweilen, wenn er ganz allein ist, sich selbst, den Ansprüchen,
die er an sich stellt oder welche die anderen an ihn stellen, den
Vorstellungen von sich selbst entrückt, morgens im Bett vor dem
Aufstehen, die Augen gucken gerade noch unter der Bettdecke hervor,
sieht er sich selbst als Affen, ganz und gar als solchen, als einen
wirklichen Affen von mittlerer Größe, graugrün
gefärbt, mit langem Ringelschweif und buschigen Augenbrauen.
Genauer: er sieht sich selber und zugleich den Affen. Er ist dann auch
er selbst und zugleich der Affe. Und dieser kauert irgendwo im Zimmer,
das zugleich das Schlafgemach des Schauspielers ist und doch auch ein
anderes, fremdes, großes, ein Zimmer des Geistes im Leeren
irgendwo. Der Affe kauert oben auf dem Ofen, genauer: am Rande
desselben, seinen Hinteren einem etwas schadhaften Merkur weisend. Von
da starrt er aufs Bett, so daß man erwarten muß, er werde
jetzt dorthin springen: direkt aufs Bett. Statt dessen ist er aber mit
einem einzigen sicheren Satz am Kleiderschrank und dreht sich dort um
und starrt oder glotzt wiederum zum Bett hin. Wirst du vielleicht jetzt
hergesprungen kommen? Nein, wiederum nicht, vom Kleiderschrank geht es
im Satz zum Schreibtisch, mitten auf die Mappe drauf, und schon
hängt er am Reck, das dann gegen die Tür anschlägt, und
so geht es fort.
Wohin wird er sich im nächsten Augenblick setzen? Es ist so, wie
wenn es der Affe selbst vorher nicht wüßte und sich
292
erst
im Sprung und durch ihn davon zu überzeugen hätte, wohin und
daß er springe. Es ist ferner so, wie wenn jeder Gegenstand, auf
dem er sich nach dem Sprung zu halten sucht, aus jenem Leeren erst auf-
und erstünde, in welches der Affe unter seinen buschigen
Augenbrauen hervor starrt, starrt aus der großen und einzigen
Spannung heraus, darin er wie gebannt liegt. Und diese in Sprüngen
und Sätzen sich lösende Spannung liegt im Gesicht des
großen Schauspielers unter der Bettdecke, ist in das Gesicht
übergegangen, so daß aller Ärger, alle Kränkung
bis auf den letzten Rest daraus weggewischt, daß alle
Winkelzüge darin ausgeglichen, alle Vorbehalte zurückgezogen
erscheinen müssen für den, der den Schauspieler die ganze
Zeit über, da dieser dem Affen mit dem Geistesauge gefolgt war, zu
beobachten in der Lage wäre.
Aus dieser Spannung, Erregung, Freude und Seligkeit verfällt er,
verfällt vielmehr sein Gesicht, sobald der Affe genügend
lange herumgesprungen ist, von selbst, wie von einer großen
Höhe herab, auf der sich kein Mensch allzulange zu halten vermag,
in eine große, in eine grundlose Trauer, doch so, daß er
sich gerne davon bergen läßt, daß er darin jetzt eine
Zeit lang wie verkrochen weilen möchte: in dieser großen,
ganz grundlosen Trauer. Er weiß nicht, wie lange — doch soll sie
dauern, das weiß und fühlt er — soll die Trauer dauern, die
ihn jetzt umfangen hält, da der Affe weg ist und er die Bettdecke
über den Kopf gezogen hat. ,Wenn jetzt nur Marie — so heißt
seine Frau — nicht hereinkäme, nicht gleich, fünf Minuten
wenigstens nicht! Ich liebe Marie, sie ist so gut zu mir, alles in ihr
strömt Güte zu mir aus, Liebe, doch jetzt soll sie nicht
kommen. Bitte, liebe, liebe Marie, bleibe doch noch draußen, komm
erst nach ein paar Minuten, nur jetzt nicht, bitte, bitte!‘
293
In
dem Augenblick aber geht die Tür auf, und Marie tritt, das
bewegliche Reck beiseite schiebend, herein, voll Morgenfrische,
Zärtlichkeit, auf den Lippen wohl auch schon die sorgende Frage,
ob er heute wiederum habe ein Schlafmittel nehmen müssen. „Gut,
Marie, daß du kommst, daß du da bist! Gut, gut! Ich warte
schon die ganze Zeit über auf dich. Komm, setz dich zu mir her und
laß dir in die Augen sehen! So, hierher, so ist es gut.“
Mit diesem erstaunlichsten aller Affensprünge, dessen er
fähig war, ist jetzt der große Schauspieler aus seiner
großen, grundlosen Trauer, die ihn schon ganz oder fast ganz
eingehüllt hatte wie die Bettdecke seinen Körper, in die
strahlendste Freude hinübergesetzt, darin er sich nun zu halten
sucht, so lange, als es eben geht, und wie gefährlich auch immer
die Lage, darin er sich im Augenblick befindet, ihm und jedem, der ihn
kennt, erscheinen muß.
Letzte Änderung: 22. August 2025