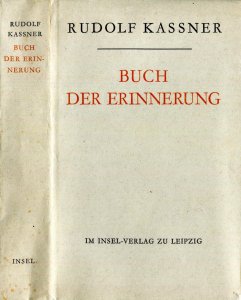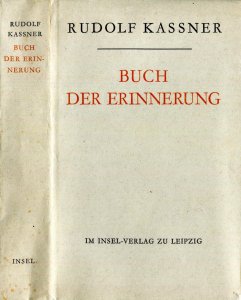RUDOLF KASSNER
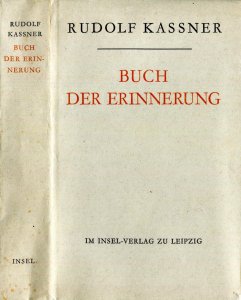 BUCH DER ERINNERUNG
1938
BUCH DER ERINNERUNG
1938
4. DER
MAGISCHE LEIB
S. 170—258
170
DER
MAGISCHE LEIB
Erinnerung an Reisen in Nordafrika, den beiden Indien und
Turkestan (1905—11)
1
Was folgt, hätte anfangs heißen
sollen: Der Barbar. Zuweilen schien mir nämlich, als hätte
ich alle
meine Reisen vor dem Kriege, die mich von Europa wegführten, um
seinetwillen gemacht, damit ich ihm endlich begegne: dem wirklichen,
dem echten Barbaren. Ich erinnere mich jetzt sehr wohl eines Satzes
aus einem Brief an eine Freundin, den ich aus Tanger schrieb, da ich
das
erste Mal afrikanischen Boden betrat. Es war einige Wochen nach dem
Besuch des deutschen Kaisers dort und dessen unglückseliger Rede.
‚Ich habe den Barbaren gesehen.‘ So lautete mein Satz. Es gab ihn
damals noch, und zwar eben den echten und eigentlichen. Ich weiß
nicht, ob es ihn heute noch gibt, nachdem er gelernt hat, in vielen
Belangen die Angleichung an die Barbaren Europas, die falschen,
uneigentlichen, zu vollziehen.
Wenn man von mir eine nähere
Bestimmung des Barbaren verlangt — ich bringe ihn keinesfalls in einen
Gegensatz zum zivilisierten Menschen. Es wäre auch falsch, wenn
einer Barbarentum und Kultur einander gegenüberstellen wollte, wie
es die Griechen getan haben aus ihrer Idee von Maß und Freiheit
heraus. Der Barbar, den ich gesucht und noch gefunden habe, hatte oft
mehr
171
Kultur als
vielfach der Zivilisierte beider Hemisphären. Doch das weiß
man schon alles. Dem Barbaren gegenüber, wie ich ihn verstehe, ist
mir beides fremd geblieben: der Hochmut und die Abwehr des Griechen
ebenso wie die Verhimmelung des Romantikers in der Art Byrons oder Chateaubriands
und vieler anderer. Mich hat nie darnach verlangt, sein Kostüm zu
tragen, seine Gewohnheiten nachzumachen oder für eine gewisse Zeit
anzunehmen, auf seiner Spur der Liebe zu folgen und seine Weisheit oder
seine Art von Frommheit oder Gottgläubigkeit zu versuchen, wie es
etwa der in meiner Jugend viel gelesene Pierre Loti getan
hat, dessen Buch über Indien das schlechteste ist von denen, die
ich kenne, wenn ich dabei absehen will von einem deutschen über
denselben Gegenstand, das gleich nach dem Kriege in einigen
hunderttausend Exemplaren auf den Markt geworfen wurde.
Der Barbar also war für mich der Mensch von anderer Art, mit einem
anderen Lebensrhythmus, einem anderen Gefühl für Gegenwart,
mit einer anderen Tiefe. Gewiß, aber es war da noch etwas
vorhanden, was mich von ihm unterschied und das ich gleich fühlte,
kaum daß ich seiner gewahr geworden war in den ersten
Verkörperungen: ein anderes Ichbewußtsein und daraus dann
resultierend das andere Selbstgefühl. Auf den ersten Blick lag der
Unterschied zwischen mir und ihm darin, daß ich wohl auf ihn, er
aber keineswegs auf mich neugierig war. Mehr noch als das: daß
ich von vornherein, vom Ich her neugierig war, auf das Fremde
eingestellt, dieses suchend und darum über die Grenzen des
Gegebenen hinausdrängend, er hingegen völlig eines blieb mit
seiner Welt, darin ich als Feind funktionierte, Feind seiner Welt. Und
wenn er neugierig war, so war er es auf
172
mich
als seinen Feind, so war er es mit der Waffe in der Hand. Ich hatte
damals sehr deutlich das Gefühl: er hat gar kein Ich, so wie ich
es habe: als Vorwand, als Schwierigkeit, sondern statt dessen gleich
Leidenschaft, Begehren, Lüge, Offenheit und was es sonst noch
wäre. Und das müßte man ihm ansehen und anfühlen.
Und darum bin ich gereist, um ihm das anzusehen und anzufühlen.
Was heißt das nun: das Ich als Vorwand, das Ich als
Schwierigkeit? Das soll noch mit Hilfe von Beispielen erläutert
werden. Erst viel später, nachdem ich nach dem großen Kriege
alles Reisen aufgeben mußte, bin ich zur Konzeption des magischen
Menschen ohne Ich (als Vorwand) gelangt, zur Konzeption des magischen
Menschen mit dem Ich als purer Mitte, zur Idee vom magischen Leib
(Leibseele, Seelenleib), der zerrissen oder zerteilt werden kann und
trotzdem ganz bleibt und heil, und zwar genau darum, weil er nicht
unser vorwändiges, schwieriges Ich, sondern statt dessen eben
Mitte hat, den Rausch der Mitte, den Rausch als Mitte.
Diese Konzeption oder Idee bekam ich, wie gesagt, erst nach dem Kriege;
des magischen Leibes aber war ich schon vorher ansichtig und gewahr
geworden. Es war, kurz gesagt, der Leib, Leibseele oder Seelenleib,
ohne Ich. Wenn wir ein Schwert oder Messer nehmen und es in diesen Leib
stoßen, so stoßen wir damit, heißt das, auf kein Ich
und können somit auch keines verletzen.
Ich sage jetzt nicht mehr darüber oder höchstens das noch,
daß wir darum und nur darum statt eines Menschenleibes, den wir
töten möchten mit einem Stoß oder Hieb, auch eine Puppe
nehmen dürfen zu diesem Zwecke, denn auch die Puppe hat kein Ich.
Kein schwieriges, kein vorwändiges.
173
2
In Chairuan nicht
weit von Tunis wohnte ich einer Sitzung, einer Kulthandlung der Aissauahs
bei, einer mohammedanischen Sekte Nordafrikas, verwandt jener der
Derwische. War es in einer Moschee? Nein, sondern in irgendeinem dazu
bestimmten, sonst gänzlich unbeschriebenen Raum geschieht es,
daß jeden Freitag am Nachmittag Männer sich versammeln,
ältere, jüngere, dem Knabenalter kaum entwachsen, aus allen
Ständen. Dort schließen sie um einen Alten herum, der auf
einem Schemel sitzt, einen weißbärtigen Gottesmann, ganz
dicht einen Kreis, mit Schultern, Armen und Hüften einander
berührend, aneinander haftend, und bringen sich ebbend und flutend
durch immer schneller werdendes Beugen zum Boden hin, vom Boden weg,
zueinander hin, voneinander weg unter heiseren, sehr lauten, im
Augenblick bis zum Schrei anwachsenden Atembewegungen, die im Rhythmus
der Biegungen der Körper bleiben, in einen Zustand des Rausches,
währenddessen von Zeit zu Zeit einer, der mit der Berauschung bis
an den Rand gefüllt ist, ausbricht aus dem Kreis und mit den
Augen, nein: nicht mit den Augen, da diese jetzt wie geblendet sind,
sondern mit dem ganzen bebenden Körper fleht zum Alten in der
Mitte hin, daß man ihm einen Skorpion oder Glasscherben oder die
mit Stacheln durchsetzte birnenförmige Frucht einer Kaktee zum
Kauen und Verschlucken reiche oder ihm den Arm oder eine der Wangen mit
einem dolchartigen Schwert durchbohre, was dann einer von den paar
Männern im Inneren des Kreises auch gleich tut. Sobald das
geschehen und die Übung vollzogen ist, geht der trunken Leidende
zum Gottesmann in der Mitte, der, ohne sich vom Schemel zu erheben, ihm
ganz leise ein Wort aus dem Koran, ein
174
heilendheiliges,
ins Ohr haucht, worauf jener das Bewußtsein wiedererlangt und als
ein Erwachter aus dem Kreis der Trunkenen heraus unter die Zuschauer
tritt.
Ich sehe ihn noch vor mir, den zauberhaft schönen Jüngling,
der Rasse nach Berber, von weißer Hautfarbe, der sich bei Beginn
der Kulthandlung unter die Zuschauer mischte, darunter Europäer
waren gleich mir, unser Erstaunen durch seine
übermäßige Schönheit ebenso erregend, wie vor 2000
Jahren und mehr Charmides
Staunen und Empfinden der Männer um Sokrates erregt hatte, da
jeder von diesen, als der Jüngling sich zu ihnen gesellte, das
Verlangen verriet, daß er sich neben ihn setze. Plötzlich
aber war der junge Berber, ohne sich weiter um unser Staunen zu
kümmern, aus den Zuschauenden verschwunden, im lärmenden
Strom der Berauschten untertauchend, auftauchend, davon so lange
gehalten, bis wir auch ihn im Innern des Kreises vor den Männern
der Skorpione, Schwerter und Stachelfrüchte sahen, wie er mit
seinem schönen Körper flehte, daß man ihm die Wange
durchbohre... Am nächsten Morgen traf ich ihn vor dem Hotel an, wo
er, ein Holzkistchen unter dem Arm mit Bürsten darin, schwarzen
und gelben Pasten, auf die Fremden wartete, sollte einer von ihnen den
Wunsch haben, daß ihm die Schuhe geputzt würden. Von der
Wunde in der Wange war nur mit Mühe eine Spur zu finden, doch im
Gesicht, um die Mundwinkel, im Auge lag ein Trauriges, das ich gestern
nicht wahrgenommen hatte.
Abseits aber von den Zuschauern im Kultort kauerten in verdunkelter
Nische hinter einem Holzgitter Frauen, auf dem Schoß Kinder, die
sich mit ihren Händchen da und dort an das Gitter klammerten. Die
Frauen waren unverschleiert, doch konnte man nicht mehr von
175
ihnen
wahrnehmen als hier und da ein dunkles, sehr leuchtendes Augenpaar, das
gleich wieder, sobald es sich beobachtet sah, ins Dunkle der Nische
zurückwich oder sich hinter einem nackten Kind verbarg. In
bemessenen Intervallen aber ertönte immer wieder aus dem Dunkel
ein zischender, züngelnder, tierhafter Laut, Schrei oder wie man
das nennen will, was diese Frauen ausstießen, indem sie die Zunge
im Munde heftig bewegten. Es drang mir bis ins Mark. Mit demselben Laut
hörte ich in Susa
Frauen, abseits vom Getriebe des Bahnhofes zu einem Haufen
zusammengeschart, wiederum Kinder mit den braunen entblößten
Armen festhaltend, zwei Pilger empfangen, die, aus Mekka kommend, dem
Eisenbahnzug entstiegen. Es gibt keinen ähnlichen, ähnlich
aufwühlenden Laut unter Menschen. Gehirn und Geschlecht sind darin
eines, die Zunge ist kein Organ mehr der bloßen Rede oder des
bloßen Geschmacks. Dieser Laut kommt aus keinem Ich.
Ebensowenig wie das leise Pfeifen der Kobra in der Paarungszeit aus
einem Ich kommt. Mich hat in Madras einmal eine Russell-Viper mit
einem so furchtbar stoßend-zischenden Laut angefahren, daß
ich vor Herzklopfen keinen Schritt weiter machen konnte. Auch dieser
Laut kam aus keinem Ich, sondern war ein Laut aus der Mitte, aus
magischer Mitte.
Ich habe im Leben erfahren, daß alle Tiere, nicht nur Schlangen,
sondern auch der Maulwurf, ein Sandkäfer, darum eine so
große Kraft besitzen, weil sie unter allen Umständen aus der
Mitte wirken und gar nicht anders können. Wir Menschen wirken nur
unter den besonderen Umständen der Begnadung oder Befeuerung aus
der Mitte. Man kann es auch so sagen: weil oder insoweit wir nicht
gleich den Tieren aus der Mitte wirken, haben
176
wir
die Imagination, welche den Tieren, welche aber auch den Aissauahs, dem
magischen Leib, dem magisch Menschen, fehlt. Darum ist dieser ganz
stark oder ganz schwach, aber niemals so gleich uns mit unserem
vorwändigen, schwierigen Ich stark und schwach zugleich.
3
Ich suche mir das, was ich die Schwierigkeit des Ichs oder das Ich als
bloße Schwierigkeit nenne, an Beispielen klarzumachen: Jener
japanische Soldat gleich, der sich mit vielen Hunderten von Kameraden
darum bewirbt, zusammen mit einem von ihm zu lenkenden
Torpedogeschoß, daran er angeschlossen oder daran er gebunden
wird, zu explodieren und in tausend Stücke zerrissen zu werden,
hat kein schwieriges Ich oder keine Schwierigkeiten damit. Ich
möchte sagen, daß er daran, am Ich, weder hängen noch
darin stecken bleibt. Er lebt so, wie er ist, in der Mitte zwischen der
magischen Welt der Wiedergeburten oder Vergeltungen und jener
Termitenwelt, darin den Kriegern die Rüstung und Waffe an den Leib
angewachsen ist, gleichwie uns Arm und Bein angewachsen sind. Darin
lebt er, und mitten durch beide Welten geht er, geht sein Leib hindurch
und explodiert am Ziel. Wenn er unser Ich mit allen Schwierigkeiten und
den daraus resultierenden Vorstellungen und Ideen von
Individualität, Freiheit, wenn er unsere Imagination hätte,
würden sich vor dem Explodieren am Ziel allerlei Hindernisse
ergeben müssen, und das Explodieren möchte nicht so leicht,
so spielend, so spontan vor sich gehen.
Die Vorstellungen der alten Perser nach Cyrus vom
Menschenleib waren magisch. Herodot ist eine Fundgrube für
Beispiele solcher Art. Bei stürmischer See, da das Schiff mit Xerxes unterzugehen
drohte, gibt der
177
Kapitän
den Rat, daß man so und so viele Menschen ins Meer werfe, damit
auf diese Weise das Schiff leichter werde. Das geschieht, und der
König wird gerettet. Zum Dank für seine Rettung hängt
Xerxes dem Kapitän eine goldene Kette um den Hals; weil aber bei
der Fahrt dafür so viele Menschen ihr Leben lassen mußten,
läßt er ihm den Kopf abhauen. Über der Kette, wie wir
annehmen wollen. Der Kapitän war offenbar ein Mann ohne Ich,
magischen Leibes. Es gab überhaupt in dieser Welt nur ein einziges
Ich, und das hatte der König, das war der König.
Eine andere Geschichte Herodots handelt von einem Großen des
Königs, der sich für alles, was er bisher für Xerxes und
dessen Heer und Ausrüstung zum Zuge gegen die Griechen geleistet,
die Gunst ausbittet, daß einer von seinen fünf Söhnen
nicht mit in den Krieg ziehe. Worauf Xerxes erzürnt diesen einen
Sohn töten und den Leib der Länge nach in zwei Teile hacken
läßt. Und mitten durch diese beiden Teile am Wege links und
rechts, die so zerteilt sind vom Kopf herab bis zur Scham gleich dem
Leib eines Ochsen oder Schafes im Laden des Fleischers, werden die
Heere gegen die Griechen ziehen, und im Heere werden sich die vier
Brüder des Zerhackten und der Vater befinden. Was hier nicht
vorhanden ist, das ist die griechische Idee von Maß und damit in
Verbindung von Freiheit. In der Idee vom Maß des Menschen allein
liegt die Idee von dessen Unteilbarkeit.
Gleich zu Beginn meiner Reise in Indien bin ich im November 1908 einer
Einladung des Maharadschas
von Kapurthala zu dessen Geburtstagsfeierlichkeiten gefolgt. Wir
hatten uns auf dem Schiff getroffen. Bevor ich aber auch hier in
Kapurthala in Nordindien auf den eigentlichen Gegenstand meiner
Erinnerung und Betrachtung,
178
den
magischen Leib betreffend, eingehe, will ich schnell alles dessen
dankbar gedenken, was uns Engländern, Franzosen,
Österreichern in den wenigen Festtagen damals geboten wurde. Am
Abend vor dem Geburtstag großes Staatsdiner. Wir
ausländischen Gäste saßen zusammen mit dem englischen
Residenten, dem Kriegsminister, Innenminister, dem Adjutanten an der
Tafel des Fürsten und dessen europäischer Frau, einer
gewesenen Tänzerin aus Malaga von großer Schönheit.
Rechts von unserer Tafel durch eine Glaswand getrennt aßen die
Hindunotabeln, links gleichfalls durch eine Glaswand geschieden in
einer Art von Veranda die mohammedanischen Männer von Amt,
Würde und Vermögen. Diese bekamen Schöpsenfleisch,
Kuhfleisch, jedes Fleisch, die Hindu höchstens Hühnerfleisch.
Uns aber war das Essen von einem französischen Koch zubereitet.
Der Adjutant des Fürsten, Patriot, Bengale, der Brahmanenkaste
angehörend, Feind der Engländer, aß vom Roastbeef
gleich uns, und ich hütete mich sehr davor, eine Bemerkung in
dieser Richtung fallen zu lassen, denn er war gleich beleidigt und
wollte genau so sein wie wir, wie wir Männer aus London, Paris und
Wien, er wollte als Inder nicht einmal die indische Sonne richtig
vertragen, wie sie ein Bengale eben verträgt, trug einen
Tropenhelm und sprach dazu Cockney-Englisch.
Am Tage darauf sahen wir von oben aus Logen dem Durbar zu: der
Maharadscha sitzt auf dem Thron, und seine steuerpflichtigen Untertanen
bringen, vom Herold dazu aufgefordert, dessen melodischer Ruf durch die
Säle tönt, von fern an das Rufen der Muezzins von der Moschee
herab erinnernd, doch anderen Ursprungs, jeder auf einem weißen
Tuch, einer Art Serviette, in goldener Münze den Zehent, welchen
der Maharadscha mit
179
sehr
lässiger Gebärde der Hand einstreicht und in einen neben dem
Thron liegenden Sack aus grobem Leinen fallen läßt. Hinter
Schleiern verborgen, sahen die drei Hindufrauen des Maharadschas, uns
gegenüber sitzend, der Zeremonie zu. Wir wurden gebeten, nicht
neugierig zu sein und etwa mit unseren Gläsern durch die Gaze der
Schleier hindurchzudringen zu suchen. Nach dem Diner, um das noch
schnell nachzuholen, hatte es Nautschmädchen gegeben, die tanzten
und sangen, darunter eine berühmte Primadonna aus Agra, der,
während sie sang, Betel in braunem Strom über die schlechten
Zähne aus dem Mund floß. Mir fiel auf, wie sich die
Mädchen, sobald ein Tanz oder Lied beendet war, sofort auf dem
Boden hinkauerten, mit ihren kostbaren Gewändern von allen Farben,
den mit Juwelen übersäten Hälsen und Köpfchen den
herrlichsten aller Teppiche bildend. Eine Hindufrau darf nicht stehen,
herumstehen, stehend anordnen. Das erste, was sie beim Betreten des
Abteils im Eisenbahnzug tut, ist: sich setzen, sich hinkauern. Dann
erst kommen der Mann, die Diener, Dienerinnen, bringen Koffer,
Körbe, Schachteln und ordnen alles um sie herum, während sie
sitzt und vor lauter Dasitzen kaum den Mund aufzutun oder zu denken
wagt.
Was gab es noch in Kapurthala? Eine Parade der zwei Sikhregimenter,
welche die englische Regierung dem Maharadscha erlaubt. Ein
pig-sticking. Auch wurde abends eine Ziege draußen im Dschungel
angebunden für den Panther oder Leoparden, den einer der
Gäste erlegen sollte. Und endlich gab es auch ein großes
Mißverständnis meinerseits, das verzeihliche
Mißverständnis des Europäers, und zwar kurz vor meiner
Abfahrt am sehr frühen Morgen noch vor Sonnenaufgang. Der Wagen,
ein halbgedeckter französischer Herkunft, stand vor meinem
180
Zelt
bereit, darin ich die drei Tage und Nächte über zu wohnen
hatte, da das Gästehaus im Park voll war; zwei indische Grooms in
Turbanen, die hinter dem Fond des Wagens während der Fahrt zu
stehen hatten, hielten die Pferde vorn am Zaumzeug. Da ich aus dem Zelt
trete, redet ein Dutzend Bedienter auf meinen Diener Ali heftig ein,
der, hin und her gerissen zwischen Einsicht und Abwehr, meinen
Sonnenheim in der Hand hält, er trug seinem Rang entsprechend nie
mehr, nie einen Koffer — abseits davon steht der Sweeper, der Feger,
mit dem Besen in der Hand, der Paria. Was ist also geschehen? Ali
tritt, während die Blicke der anderen ihm aufmerksam, ja gespannt
folgen, auf mich zu und sagt mit Ehrerbietung, aber doch auch mit
Entschiedenheit: ich hätte dem Sweeper mehr Trinkgeld gegeben als
dem Brahmanen oder Mann aus der Brahmanenkaste, der mir am Morgen den
sogenannten ‚frühen Tee‘ ans Bett gebracht, und das ginge nicht an
und sei ganz ungehörig un vielleicht in Kapurthala noch nie
vorgekommen. In der Tat hatte ich europäisch gefühlt und
gedacht, mein ‚Mitleid‘ falsch placiert und irgendwie auf eigene Faust
Vergeltung im Allerkleinsten und ganz Persönlichen üben
wollen, was wohl in Europa anginge, hier aber zunächst einmal
taktlos war, sinnlos und unvernünftig. Dieses
Mißverständnis mußte also erst behoben werden, bevor
mich mein Wagen mit den beiden Hindugrooms hintem mir durch die
herrlichste Teich- und Seelandschaft führte Die Luft roch nach
verbranntem Holz, Hunderte, Tausende von Wasservögeln aller Art,
Reiher, Flamingos, Kormorane, Wildenten, Bläßhühner,
Taucher, flogen auf, segelten in der Luft, schwammen, tauchten,
schrieen, kreischten oder waren ganz stumm, da die Sonne einen roten
Tiger gleich hinter dem Schilf aufsprang.
181
Doch
das, worauf ich von Anfang an kommen wollte, war das alles nicht,
sondern war die Feier im Sikhtempel am Morgen des Geburtstags. Der
Maharadscha wird da im Festgewand aus dunkelblauem, über und
über vergoldetem Sammet mit einem edelsteinbesetzten Dolch im
Gürtel auf die eine Schale einer mächtigen Waage gestellt,
die offenbar zu den Tempelutensilien gehört; auf die andere kommen
dann ein lebendes Zebukalb, zwei oder drei Säcke mit Mehl und
Reis, ein großes Gefäß mit Butter (ghi), worauf die Brahmanen
überall in Indien heute noch so gierig sind wie vor 4000 Jahren
zur Zeit der Veden, und ein wenn auch kleines, so doch gewichtiges
Säckchen mit Goldpfunden. Das wird nun gegeneinander ausgewogen;
den Priestern, die den Maharadscha umstehen, bleibt die Austarierung
der Waage überlassen, indem sie sich nicht ohne einen gewissen
Humor an die Stricke der Waagschale hängen, auf der das
Geburtstagskind steht. Danach erst tritt der Maharadscha vor den Altar,
wo ihm vom Oberpriester aus einem mächtigen Folianten, mit Sonnen,
Monden, Konstellationen, Tierkreisfiguren, Drei-, Fünf- und sonst
welchen Vielecken, Buchstaben und Ziffern darin, das Horoskop für
das kommende Lebensjahr gestellt wird.
Es ist nun evident, daß eines bei dieser Prozedur nicht
mitgewogen werden kann: das Ich samt seinen gegebenen und
möglichen Schwierigkeiten. So ein Menschenleib gegen den Besitz,
gegen Dinge des Besitzes gewogen — das ist sicherlich die einfachste,
augenfälligste Form des magischen Leibes. Nur innerhalb der
magischen Raumwelt (ohne Ich) können Dinge auf solche Weise
gegeneinander Geltung gewinnen, Gewicht haben und auch als Dinge
bestehen.
Diese Lehre empfing ich damals sehr eindringlich im
182
Sikhtempel
von Kapurthala. Es liegt darin auch heute noch für mich der letzte
Sinn, die Uridee des Besitzes. Welche zudem auch gar nicht die Tatsache
leugnet oder zu leugnen vermöchte, daß am Besitz stets
Gewalt, Übermacht,
Gewalttätigkeit, ja Grausamkeit hängt. Wo Dinge sind und
als solche existieren, aufeinander stoßen, dort ist auch
Scheidung, Trennung
und Schwertstreich.
4
,Ich habe den Barbaren gesehen‘ — als ich das so niederschrieb im
Brief,
frohlockend darob, da hatte ich im Sinn und noch vor Augen Berber,
lange
aschblonde, die weiße Haut gebräunt, ohne Kopfbedeckung, oft
barfuß, in einer
Bekleidung, die sich von den Lumpen des Bettlers kaum unterschied, wie
sie
aus ihren Höhlen und Hütten in den Bergen rings um Tanger
nach der Stadt kamen, durch die Menschenhaufen am Markt, auf den
Straßen
hindurchstießen nach irgendeinem Ziel. Jeder trug eine Flinte,
einen sehr
langen Vorderlader, geladen, nicht geladen, oft war sie wohl nicht
geladen,
weil das Geld für die Patrone fehlte; aber diese Flinte war ein
Teil
ihres Wesens und gehörte zu ihnen wie Arm und Bein zum Körper
und das Auge zum Gesicht. Einer davon ist mir ganz gegenwärtig
heute noch. Wohin ich kam in den acht Tagen oder auf meinem Esel ritt,
bin ich ihm begegnet: immer im gleichen schnellen, entschlossenen
Schritt irgendwohin eilend, die Flinte geschultert, nicht ohne eine
gewisse wundervolle Sinnlosigkeit. Abends im maurischen Café mit
mindestens zwei Dutzend Uhren an den Wänden, von denen jede zu
einer anderen Zeit schlägt, liegt er ausgestreckt da und hört
den Uhren zu, hört den Liedern zu, die vom Verlust von Granada,
von der Wiedereroberung Spaniens singen,
183
hört
nicht zu. Die Flinte liegt neben ihm. Es ist so, wie wenn er in zwei
Teile geteilt daläge: in sich und in die Flinte. So hört er
zu und hört auch nicht zu. Da er sich vom Boden erhebt und nach
der Flinte greift, trifft sein Blick mich für den Bruchteil einer
Sekunde, blitzend. Warum erst jetzt und warum mich? Es war
merkwürdig. So wie wir beide sind oder waren: jeder in seiner Welt
oder seine Welt in sich tragend, sah ich ihn, sah er mich nicht. Darum
hatte er die Flinte, und darum war oder bin ich stets unbewaffnet im
Leben. Darum gehört zu ihm, gehört in seine Welt der Feind
draußen, der lauernde, der Dieb, der Räuber hinter dem
Felsen versteckt, hinter einem Busch auf dem Heimweg.
Der Seher ist ohne Waffe, und es gehört zu ihm, daß er ohne
Waffe ist und ohne den Feind draußen, der ihm auflauert. Darum
sieht er Geist und Seele, Seele und Körper als eines. Wenn das
auseinandergehen und sich ein Spalt bilden sollte zwischen Geist und
Seele, Körper und Seele, so müßte es soviel bedeuten
wie, daß er Unrecht hätte und litte, beides, oder daß
ein Unrechtes da wäre, dessentwegen die anderen Menschen Waffen
trügen und nicht ablegten.
Ich gedenke heute nach dreiunddreißig Jahren dieses Barbaren, den
ich nicht ließ und der mich nicht ließ, mit großer
Dankbarkeit, weil sein bloßer Anblick schon mir eine
entscheidende Lehre zu vermitteln vermocht hat. Es gibt kein
größeres Glück als das Glück des Geistes, das ich
im Zusammensehen des Vielfachen und um seiner Vielfachheit willen
Gespaltenen: Geist, Seele, Körper, erblicke. Dieses Glück
allein enthält den Frieden, den Samen des Friedens, und zwingt
uns, die Waffen im Tempel zu verschließen oder zu zerstören.
Die Verbrecher, Räuber, Diebe wurden in Tanger, wohl
184
überall
in Marokko damals hinter Eisengittern in einer Art von Käfigen, in
Höhlen oder Löchern gehalten. Jedermann, auch ein Fremder wie
ich, hatte auf solche Weise Zutritt zu den Gefängnissen, indem er
sich einfach vor die Gitter hinstellte. Der Staat sorgt nicht für
die Ernährung der Gefangenen, sondern diese waren gänzlich
auf die Opferwilligkeit der Verwandten oder überhaupt der
Einwohner der Stadt angewiesen, die ihnen Stücke Brot, Wasser oder
was immer sonst brachten. Sollten die Menschen einmal der Gefangenen
vergessen, so mußten diese verhungern und verdursten. Welche
Blicke, welche Klage aus Blicken trafen da nicht den, der vorbeiging
oder stehen blieb vor den Gittern! Die Klage kam nicht aus der Seele,
sondern aus den Eingeweiden der Seele, die wie aufgerissen und
bloßgelegt im Blick lagen. Von Revolte war auch nicht die
geringste Spur vorhanden, denn wo Revolte ist, dort sind auch
Vorstellungen, Begriffe, Ideen. Und die waren alle nicht vorhanden,
darum sage ich auch, daß die Angst aus den Eingeweiden der Seele
kam, den aufgerissenen und bloßgelegten.
Eines aber läßt sich dennoch mit aller Bestimmtheit
behaupten, daß auf dem Wege, welchen die Blicke der Angst nahmen
hin zum Auge und zur Seele dessen, der geben sollte jetzt in dieser
Stunde, Allah zu finden war und ist, Allah, der Allmächtige und
der Mildtätige, und daß ferner, wenn Allah nicht da
wäre: in der Mitte des Weges, Mitte bildend, auch der Weg nicht
wäre, dieser nicht und auch ein anderer nicht. Warum geben denn
die, so vorbeigehen und vor den Gittern halten? Aus Spontaneität,
aus der Freiheit heraus des Guten? Was soll das Gerede davon! Sie
geben, weil sie den Räuber fürchten, weil so, wie sie
beschaffen sind, auch die Räuber sind, die irgendwo und
überall lauern. Und so muß Allah zwischen
185
beiden
Frieden stiften und die Mitte bilden. Wenn es Allah nicht gäbe, so
würde es nicht nur keinen Weg geben von der Bitte zur
Erfüllung, sondern es würde dann auch keinen Unterschied mehr
geben zwischen dem Räuber und dem Beraubten, oder der Beraubte
müßte zum Räuber werden und so fort im ewigen Wechsel.
Damit das nicht geschehe, darum ist Allah und ist Allahs Dasein Gesetz
und Mitte der Welt. Und ist in seiner Allmacht auch die
Mildtätigkeit eingeschlossen. Was nur die Frommen verstehen und
bisweilen wohl auch die Weisen.
5
Herodot erzählt die Griechen hätten de Siege über die
Perser ihrer besseren Bewaffnung zu verdanken gehabt. Diese wäre
zweckmäßiger gewesen, wie wir uns heute ausdrücken, und
hätte das am Körper zu schützen gewußt, was zu
schützen war, ohne ihn darum in seiner Beweglichkeit zu hindern.
Herodot bringt, wenn ich mich recht erinnere, den Gedanken der
Zweckmäßigkeit und Wissenschaft mit der Idee des Maßes
zusammen und weiter mit jener der Freiheit, so wie die Griechen die
Freiheit verstanden haben: vom Maß her. Die Perser ließen
nach allem vieles am Körper ungeschützt und bloß, so
daß die Griechen dank ihrem technisch um so viel mehr
entwickelten Verstand mit ihnen leichtes Spiel hatten.
Die letzte Ursache für dieses Ungeschütztsein oder die Idee
davon ist aber genau die, welche ich schon vorhin angeführt habe:
der magische Leib, das magische Fleisch, die Vorstellung davon, de
magische Vorstellung vom Menschen und von der Welt überhaupt,
welche so, wie sie ist, jene andere griechische von der
Zweckmäßigkeit und vom Maß ausschließt, ja ihr
gewissermaßen entgegengesetzt ist.
186
Der
ganze Orient, der nahe und der ferne, hat sich die Idee der
Zweckmäßigkeit nie zu eigen zu machen verstanden und an
deren Stelle seit je eben die Magie besessen, womit wir zugleich auch
den weitesten Begriff für letztere gewinnen. Daß die Flinte
zu den Berbern in den Straßen von Tanger gehört wie das Auge
zum Gesicht, hat nichts mit Zweckmäßigkeit zu tun.
Ebensowenig wie der Mensch aus Zweckmäßigkeit oder um der
Zweckmäßigkeit willen geschaffen ist. Wenn wir dem Barbaren
die Waffen und den Schutz durch dieselben nehmen, so ist dieser
unbewaffnete, unbeschützte, hilflose Leib dann nicht nackt, wie
der Grieche nackt war: aus der Idee, aus der großen, das ganze
griechische Wesen erfassenden Idee des Agonalen, des Wetteifers heraus,
in welche sich jetzt die Idee der Zweckmäßigkeit verwandelt
hat. Nein, das ist der Barbar nie, er kennt die Idee der Nacktheit
nicht, vielmehr er hat diese als Idee nicht; die Idee seiner Nacktheit
ist Magie, ist Verzauberung. Genau so ist es. Und dementsprechend
besitzt er auch nicht die Idee des Wetteifers, statt dessen aber die
des Gauklers, des Zauberers, des Mannes der Tricks, welche sich zur
Magie genau so verhält wie das Spiel, der Wettkampf zur
Zweckmäßigkeit.
Ich glaube nicht, daß man den Unterschied zwischen Europa und
Asien, zwischen Griechentum und Barbarentum auf eine kürzere
Formel bringen könnte. Zuletzt birgt sie in sich die verschiedenen
Konzeptionen, die Europa und Asien von der Individualität an sich
haben.
Aus diesem Gesichtspunkt heraus habe ich erst den Gaukler, den trickman, wie er in Indien von
meinem Diener Ali genannt wurde, die Schlangenbändiger einzusehen
vermocht. Sie kamen mir immer nackt vor,
187
auch
wenn sie es nicht waren. Marokko hatte, scheint es, schon zur Zeit der
Römer die berühmtesten Schlangenbändiger; ich habe
gefunden, daß sie sowohl den ägyptischen als auch den
indischen überlegen waren. Ich erinnere mich sehr deutlich jenes
auf dem Großen Socco, dem Marktplatz von Tanger, der sich von
einer schwarzen Mamba, die zu den gefährlichsten und wildesten
Schlangen in Afrika gehört, in den Arm und in die Zunge
beißen ließ. Sie lag in einem Sack zu seinen
Füßen, und er griff in ihn hinein, wie einer in einen Sack
mit Nüssen oder Äpfeln hineingreift. Ich habe die Prozedur,
den eigentlichen Zauber schon einmal — in dem Buch Verwandlung — beschrieben: nachdem
er sich einigemal von dem wütenden Tier hat beißen lassen,
hält er ein wenig Stroh vor den Mund und bläst so lange
hinein, bis dieses Feuer fängt. Die zugrunde liegende Idee ist
offenbar: Verwandlung des Giftes in Feuer, in Sonne, Umkehr des Todes
in Leben. Bevor er Geld sammeln geht, zeigt er den Zuschauern den
Giftsack des Schlangenzahnes, indem er mit einer Stecknadel das
Zahnfleisch ein wenig wegschiebt.
Menschen, die hinter alles kommen wollen, werden jetzt ausrufen:
Schwindel, der Giftsack ist leer, er hat vorher die Mamba so lange in
ein Tuch beißen lassen, bis das Gift draußen war. Was die
Schlangenbändiger in Indien in den meisten Fällen allerdings
tun. Tatsache ist aber folgendes: daß Jahre, nachdem ich dort auf
dem Großen Socco unter den Zuschauern gestanden hatte, ein
Engländer, der — sagen wir abergläubisch: statt meiner — an
derselben Stelle stand, vielleicht ein wenig näher, von der
Schlange, Mamba oder Kobra, gebissen wurde und nach ganz kurzer Zeit
starb. Es ist anzunehmen, daß der Biß ihn im Hals, in der
Nähe der großen Schlagader traf,
188
was
den Tod in der kürzesten Zeit herbeiführen müßte.
Ich führe das nur wegen des vermeinten Schwindels an. Ich
gehöre meinem Naturell nach zu den ,Gläubigen‘, da ich es im
allgemeinen schwerer finden möchte, zu schwindeln als nicht zu
schwindeln. Im übrigen sah ich sehr genau, wie mein
Schlangenbändiger damals ein zartes grünes Kraut schnell und
unbemerkt schluckte, bevor er sich beißen ließ.
Ich denke heute diesen Schlangenbändiger, der dunkel war wie der
lange Körper der Mamba, zusammen mit den aschblonden Berbern aus
den Bergen, wie sie mit ihren Flinten einzeln durch die Straßen
der Stadt wild schritten. Das Denkwürdige am Gesicht des ersteren
war, wie es die Bewegungen der Schlange, deren wütendes
Vorstoßen in seinen Zügen aufgenommen, aufgefangen hatte und
somit zum Spiegel des Tieres geworden war, wie der Mensch sich in die
Schlange verwandeln, wie er schlangenhaft werden mußte. Darin
bestand seine Nacktheit: das Nackte des sich Verwandelnden. Er war
nackt, wie ein Tier und nicht wie ein Mensch nackt ist.
Beide, das aufgerissene Gesicht des Gauklers und das ganz verschlossene
des Mannes mit der Flinte, waren Gesichter von Fanatikern, wie man das
so nennt, zu schnell nennt, und zwar darum zu schnell, weil man keine
sehr genaue Vorstellung damit verbindet. Ich möchte hier meinen
aus der Anschauung gewonnenen Begriff davon hersetzen: der Fanatiker,
auch der Fatalist — beide Begriffe decken sich nicht, schneiden sich
aber —, kennt das eine nicht: das tat
wam asi, das: Das bist du
der Buddhisten oder jenes tua res
agitur des Römers. Warum? Weil er keine Einbildungskraft,
keine wahre, hat. Darum muß sich der Gaukler von der Mamba in die
Zunge beißen lassen oder, wie ich mich
189
oben
ausgedrückt habe, sich in die Schlange verwandeln, oder darum
schlucken die Aissauahs Skorpione, Glassplitter und lassen sich die
Wange durchbohren mit der Spitze eines Schwertes, und darum gehört
zum Berber die Waffe dazu wie das Auge zum Gesicht, darum setzt er sich
gleichsam in der Waffe fort und sieht mit ihr. Die meisten Menschen,
denen der tiefe Begriff der Einbildungskraft fehlt, werden das
Gegenteil für wahr halten und meinen, der magische Mensch, der
Fatalist, der Fanatiker hätten mehr Einbildungskraft als wir oder
als die Griechen, die sich so schnell aller Dinge zu entkleiden
wußten: um des Maßes willen. Die Wahrheit ist, daß
jener, der magische Mensch, der Fatalist, der Derwisch, eben die Magie
und den Fatalismus hat an Stelle der Einbildungskraft.
Beim Anblick des Kampfes zwischen einer Kobra und einem Mungo, den ich
im Hotelgarten in Ahmedabad für fünf Rupien inszenieren
ließ, ist mir aufgefallen, wie der Körper des kleinen,
unglaublich behenden Raubtieres, dessen Fell so feucht glänzt, als
ob es aus allerdünnsten Schüppchen bestünde, und das
keineswegs gegen das Gift der Schlange immun ist, wie manche meinen,
und den Sieg nur seiner Geschicklichkeit und Flinkheit verdankt, dem
der Schlange immer ähnlicher wird für den, der hinsieht, wie
er sich zu biegen, ja zu schlängeln weiß wie die Kobra
selber. So muß, sage ich, auf höherer Ebene der
Schlangenbändiger zur Schlange werden. Darum ist er nackt, nackt
von der Nacktheit alles sich Verwandelnden, nackt wie das Tier und
nicht nackt, wie der Mensch nackt ist, der Mensch als Maß der
Dinge genommen. Dieses Nackte des Maßes kennt der Orient nicht,
die Nacktheit des Griechen ist ihm Wesentlich fremd. Was hat er statt
dessen? Eben die Ein-
190
heit
als Ausdruck und Ziel der Magie. Europa hat um des Maßes willen
die Trennung von Subjekt und Objekt, von Mensch und Ding zu betreiben,
Asien, Afrika verlangen die Einigung beider. Der Ausdruck, der letzte,
endgültige, von dieser aber ist die Magie.
Alle Kunst nun in dem Bereiche des Magischen ist auf den Tanz
zurückzuführen. Sagen wir es so: Die Einheit, die
endlich-unendliche Einigung von Mensch und Schlange kann ideell nur im
Tanz dargestellt werden. Oder in der Skulptur der indischen Tempel,
soweit Skulptur erstarrter Tanz bedeutet. Und insoweit sie aus dem Tanz
kommt oder der Tanz vor der Skulptur da war, ist alle Kunst magischen
Ursprungs. Das war eine von den Lehren, die ich im Anblick der
südindischen Tempel von Madura, Tanjor und anderer empfing. Im
Tanz, kann man auch sagen, finden wir den Übergang, die
Brücke aus der Welt des Kultes und des magischen Leibes in jene
der Idee und des Dramas, in jene des Maßes.
6
Bevor ich in Tanger landete und das erste Mal in meinem Leben Europa
den Rücken zukehrte, bin ich durch Wochen in Spanien gereist und
habe vielen Stiergefechten beigewohnt. Am Auferstehungsonntag in
Sevilla, vor allem aber in Madrid. Ich gestehe offen ein, daß ich
damals vor mehr als einem Menschenalter den Donnerstag und Sonntag, an
welchen Tagen, zumal in Madrid, die Stiergefechte stattfanden, jedesmal
nur mit der größten Ungeduld erwarten konnte, daß mein
Körper, meine Nerven danach wie nach einem Gift fieberten,
daß aber die Erregung schon in der Pferdebahn, darin ich, von der
Plaza de toros bis zur Plaza del Sol fahrend, Platz fand, einem
schwermütigen Unbe-
191
hagen
— der Zustand ist nicht genau zu fassen gewesen — zu weichen begann.
Was mich freilich nicht gehindert hat, drei Tage darauf mir wiederum am
Morgen schon einen Sitz ,im Schatten‘ für die Corrida zu sichern.
Trotz allem Fieber und aller darauffolgenden Schwermut fand ich sehr
bald eines heraus, daß entweder die Stiere zu gut für den
Toreador und die ganze Mannschaft der Picadores und Banderilleros oder
umgekehrt die Stiere zu unwillig und träge waren, als daß
sie vermocht hätten, alles aus dem Toreador und der
Begleitmannschaft herauszuholen, was in diesen gesteckt haben mochte.
Daran hat auch eine Corrida real
in Aranjuez, welcher der König beiwohnte und darin es nur Stars
gab, nichts ändern können. Ganz befriedigt war ich vielleicht
nur einmal, als der damals berühmteste, an den Schläfen schon
ergrauende Toreador Fuentes eine Stufe in der Rangordnung herunterstieg
und den Banderillero abgab. Es war ganz wunderbar anzusehen und
höchst erregend, wie er sich vom Stier angreifen ließ und
ihn dann einfach damit zum Stehen brachte, daß er ihm ruhig,
bedacht und ohne auszuweichen die zwei Banderillos, statt ihn damit zu
spicken, zwischen die Hörner legte. Ich erinnere mich noch sehr
wohl, wie ich mir nach der Corrida auf dem Heimweg sagte: das
Vollkommene und ganz Richtige im Leben und auf Erden wäre
vielleicht mit Sicherheit nur zu erreichen, wenn man es vermöchte,
alles um eine Klasse, einen Rang herabzusetzen, herabzuschrauben, jeden
General zum Oberst, jeden Toreador zum Banderillero zu machen und so
weiter, wenn man mit einem Wort die Spitzen abschlüge, wie
Alkibiades in der Nacht vor dem Auslauf der Flotte die Hermesköpfe
abgeschlagen haben soll nach der Meinung der Athener.
192
Mit
dem einen Versuch, diese von Grund aus zynische Weltanschauung
auszuspinnen, hatte ich zugleich den anderen unternommen, so gut es
ging, das an Melancholie grenzende Unbehagen zu überwinden oder
zum mindesten niederzuhalten. Ich erinnere mich aber nicht, wie weit
ich damals schon im Ausspinnen und Zu-Ende-Denken meiner Idee gekommen
war. War ich schon so weit, mir sagen zu können, daß nur in
einer Welt der Zu- und Glücksfälle, in einer Welt des Spiels
die Spitze oben zuletzt fehlen dürfte, und daß Spitze, Idee,
Maß und die Gesichte der Seher, daß alles das nur Ausdruck
sei für die große Unausweichlichkeit, das
Schicksalmäßige, dem wir alle unterliegen?
Aber noch etwas viel Entscheidenderes sollte ich mir als Lehre aus den
Stiergefechten holen. Ich weiß nämlich eines sehr genau: das
Drama zwischen Mensch und Stier, das wollte ich haben, das wollte ich
erlebt haben. In diesem Sinne muß ich mich in den Briefen
geäußert haben, die ich von dort an Hermann
von Keyserling geschrieben habe, und auch später, als ich
heimgekehrt war, in Gesprächen mit Freunden, soweit solche von
Fragen nach dem Wesen des Dramatischen beunruhigt waren, wie etwa Hugo von
Hofmannsthal, den ich in diesen Jahren viel sah. Damit, daß
es ein Drama sein sollte, ein Trauerspiel, in dessen letztem Akt der
Toreador mit seinem hinter einem dunkelroten Tuch versteckten Degen vor
den Stier tritt, der vor Erregung und Erschöpfung schwer atmet,
wollte ich mir das Ganze humanisieren, da das Drama im letzten nur eine
Auswirkung des Humanen sein kann und soll. Und doch fühlte ich
hinter allen Wünschen das eine, daß es eben kein Drama sei,
was da zwischen Mensch und Stier geschieht, daß zum Drama etwas
gehöre, was hier un-
193
bedingt
fehlt: Gleichgewicht, Gleichmaß, die Einigung zwischen den
Partnern, eine Einigung im höheren Sinne. Eine solche war nun
nicht da, und je mehr ich nach ihr suchte und sie verlangte, um so
weniger war sie da. Das fühlte ich damals, aber über dieses
Gefühl kam ich nicht hinaus.
Heute weiß ich, daß es ein Drama weder war oder ist noch
sein konnte oder kann. Was aber ist es? Der Rest eines kultischen
Aktes, den Kampf zwischen Mensch und Dämon darstellend, was in dem
meinem Gefühle nach Labilen, in dem, um die Sprache des Sports zu
sprechen: Unfairen der Handlung zwischen Mensch und Stier zum Ausdruck
kommt. Wir finden dasselbe Labile auf Bildern des Quattrocento, den
Kampf zwischen dem heiligen Georg und dem Drachen darstellend. Ich
denke im besonderen an ein kleines Bild aus der Sammlung des Grafen Lanckoroński,
welches früher dem Paolo Uccello
zugeschrieben wurde. Das ein wenig Affektierte, Zierlich-Zierhafte,
Spielerische zwischen dem Ritter und dem Drachen ist nur der Spiegel
des Labilen, des Ungleichen im Kampfe. Was kann der Mensch gegen das
Ungeheuer, und was dieses wiederum gegen die göttliche Sendung?
Alles Drama kommt aus dem kultischen Akt, aus der kultischen Opferung;
im Stiergefecht freilich, wie es heute verläuft, ist dieser
ursprüngliche Akt abgeleitet worden in ein grausames, nerven- und
blutaufpeitschendes Schaustück für die Menge, darin der
Einzelne als solcher, das heißt hier: als maßgebender,
wertbestimmender Faktor fehlt oder, soweit er da ist, aus dem Gegensatz
von Erregung und Unbehagen nicht zu seiner Bestimmung zu gelangen
vermag.
Ich finde keinen geeigneteren Ort als diesen, um folgendes hinsichtlich
des Dramas zu sagen: Zum Drama ge-
194
hört
beides, der Einzelne und die Menge. Das heißt auch, daß das
Gleichgewicht und die Spannung innerhalb des Dramas genau jener
zwischen dem Einzelnen und der Menge entspricht oder dahin
übertragen werden könnte. Weshalb letztere für sich
genommen immer im Grunde dramatisch ist. Aristoteles redet von der
Spannung zwischen Mitleid und Furcht im Zuschauer, von der Mischung
beider; nun bin ich überzeugt, daß diese Spannung und
Mischung von Mitleid und Furcht im Zuschauer auf jene — sagen wir:
ältere, ursprünglichere zwischen dem Einzelnen und der Menge
zurückgeführt werden muß.
Noch das: im kultischen Akt als solchen ist keine Grenze gezogen
zwischen Mensch und Dämon, Mensch und Gott, Mensch und Tier. Daher
dann, noch einmal, die kolossale Labilität, das Abschlachten am
Schluß, ferner auch die Zerstückelung des Stierfleisches,
welches an die Armen um wenig Geld am Ort selbst verkauft wird. Viele
darunter, bin ich überzeugt, werden es so essen, wie Wilde das
Fleisch des getöteten Feindes essen, ob Mensch oder Tier: um
dessen Kraft sich anzueignen.
Im Drama aber und mit demselben ist die Grenze gezogen zwischen Mensch
und Tier, Mensch und Dämon, Mensch und Gott. Und damit setzt dann
das Maß, setzt die Idee des Maßes, die Idee überhaupt
ein. Zuerst aber war, darf nicht übersehen werden, das Drama da
und vor dem Drama die magische Opferung, der Blutrausch und manches
andere solcher Art.
Im Zusammenhang damit möchte ich noch etwas sagen, was ich damals
in der Jugend gewiß mehr zu fühlen vermochte, als daß
ich es wirklich gewußt hätte. Die ganze spanische Kunst,
gewiß auch der spanische Mensch haben auf eine gewisse Weise,
sagen wir es so:
195
im
Vergleich mit dem Franzosen vor
dem Maß, vor der Idee
Halt gemacht, sind davor stehen, sind bei der Leidenschaft geblieben
und nicht darüber hinausgegangen. In einem sehr bestimmten Sinn
ist der Spanier jener Mensch, der sich am weitesten vom Griechen, wenn
wir das Griechische als die eigentliche Wurzel des Europäischen
nehmen wollen, entfernt gehalten hat.
Der endgültigste Ausdruck für dieses Entferntsein liegt
zweifellos in Don Quijote vor. In Don Quijote als jenem Einzelnen, der
in der Menge, die dem Toreador nach der Tötung des Stieres
zujubelt, fehlt, weil er — was tut? Weil er gegen Windmühlen
ficht. Ich liebe, beide zusammen zu denken: den Toreador und Don
Quijote, von dem Dostojewski sagt, daß er nach Christus der
edelste Mensch war von denen, die auf dieser Erde gewandelt sind.
Wenn ich mich recht erinnere, fiel mir damals die Maßlosigkeit
besonders im spanischen Barock auf, wenn das überhaupt noch Barock
genannt werden darf, was im 17. Jahrhundert in der Kunst entstand.
Darin hatte sich die Einigung zwischen den beiden Elementen des
Naturalismus und der puren Phantastik, des rein Dekorativen, niemals so
vollzogen wie im italienischen oder im österreichischen Barock.
Und dann das noch: an die Kämpfe im heutigen Spanien denkend,
fühle ich dieselbe Maßlosigkeit, dasselbe
Kompromißlose wie vor so vielen Jahren bei den Stiergefechten und
als Folge davon in mir selbst dasselbe an Schwermut grenzende Unbehagen.
7
Ich will hier keineswegs eine Abhandlung über den magischen Leib,
über Magie und so weiter schreiben, sondern Erinnerungen aus
fremden Erdteilen, an Völker,
196
Rassen
unter eine einzige Idee, eben des magischen Leibes, bringen und damit
beleuchten. Ich habe schon Beispiele für das, was ich unter dem
magischen Leib verstehe, gegeben: das einfachste und deutlichste
scheint mir doch das vom Schiffskapitän des Xerxes zu sein, dem
der König zuerst eine goldene Kette um den Hals hängen und
den er dann enthaupten ließ. Man könnte, wenn man
darüber zu philosophieren hätte, folgendes sagen: Dieser
Schiffskapitän ist ein Mensch ohne ,seinen Widerspruch‘. Und darum
geht das Schwert des Richters so glatt und widerstandslos genau
über oder unter der goldenen Kette durch den Hals durch und trennt
Haupt vom Rumpf. Statt Mensch ohne seinen Widerspruch darf auch Mensch
ohne Humor oder Mensch in einer Welt ohne Humor gesagt werden. Wobei
nur noch hinzugefügt werden müßte, daß, da ihn
König Xerxes nicht hat, ihn unmöglich die Untertanen haben
dürfen. Die magische Welt ist wesentlich humorlos, oder der Humor
ist darin rein phallischen Ursprungs und phallischer Art, ist auf das
genaueste die phallische Groteske.
Ich habe den persischen Schiffskapitän zu Beginn als Mann ohne Ich
bezeichnet. Das ist insofern richtig als dort, wo kein Widerspruch ist,
auch kein Ich sein kann. Ich frage aber jetzt: Hat er nicht vielleicht
genau genommen zwei Ich — eines für den Rumpf, eines also, das
belobt wird und die goldene Halskette bekommt, und dann das andere, das
getadelt und zugleich mit dem Kopf abgehackt wird? Oder hat er nicht
trotz allem nur eines, dieses eine Ich aber ließe sich teilen wie
ein Apfel oder wie eine Körperzelle? Also nicht so teilen, wie
sich ein Mensch teilen läßt: in sich selbst und den
Widerspruch? Man sieht, daß sich auf unserem Schiffskapitän,
197
der
vor mehr als zweitausend Jahren auf so sinnvolle Art und Weise
geköpft wurde, eine ganze Philosophie aufbauen ließe, was so
vielleicht von keinem anderen Kapitän behauptet werden könnte.
Nehmen wir nun an, daß dieser Schiffskapitän auferstehen
werde nach dem Tode, was ohne weiteres zugestanden werden muß.
Dann wird am Halse die Schnittfläche zu sehen sein und der
Kapitän daran unter den anderen erkannt werden. So erscheinen auch
einige von den Märtyrern mit ihren Verletzungen, Wunden, Hieben
und Schnitten am Jüngsten Tage, und so waren im Herzen der
heiligen Klara
von Montefalco, als man ihren Leib öffnete, um ihn
einzubalsamieren, die Leidenswerkzeuge Jesu Christi eingeprägt.
Oder so verbreiten die Leiber der Heiligen nach ihrem Tod nicht den
Geruch der Fäulnis um sich.
Der Moslem überall in Afrika sowohl als auch in Indien hat die
bestimmte Vorstellung, daß, wenn er mit einem Bein oder Arm oder
Ohr stirbt, er oder sein Leib auch mit einem Bein oder Arm oder Ohr
auferstehen werde. Als im
Jahr 1857 während der Meuterei, welche die völlige
Einverleibung des größten Teiles von Ostindien in das
britische Imperium zur Folge hatte, einige von den aufständischen
Truppen im Norden mit Worten nicht wiederzugebende Bestialitäten
an englischen Frauen und Kindern begangen hatten, wurden, heißt
es, die Leiber der Rädelsführer vor die Mündung von
Kanonenrohren gebunden und in tausend Stücke zerschossen: damit
nichts, keine Identität übrig bliebe, die ruhmbedeckt im
Paradies auferstehen könnte, vielmehr müßte. Auch hier
liegt der Fall vor vom Menschen ohne seinen Widerspruch Das Ich ist
mitzerschossen worden in tausend und aber tausend kleine Teilchen, was
sich alles ge-
198
wissermaßen
als undurchführbar erwiese, wenn ein Widerspruch da wäre.
Eine andere Form der Bestrafung des ,magischen Leibes‘ war in
Nordindien die, daß man den Leib des Rebellen oder Verbrechers
mit einer Schweinshaut umhüllt und ihn also, für alle
Ewigkeit verunreinigt, hängen läßt. Alle kultischen
Reinigungen und Waschungen, aber auch alle Formen der Befleckung haben
die Vorstellung des magischen Leibes zur Voraussetzung.
Der Mohammedaner hat weder die christlich-paulinische Idee vom
verwandelten oder verklärten Leib noch jene der Hindus von der
Wanderung der Seele durch viele Leiber von Menschen und Tieren. Was
sich alles, wenn es richtig verstanden wird, auf die große
Identitätsformel des Islams Allah
ist Allah zurückführen läßt. Gott allein,
heißt das, ist Geist, der Menschengeist dagegen Logik, und zwar
genau jene, welche die Körper wohl berühren, aber nicht
verwandeln kann. Mit dieser großen göttlichen
Identitätsformel hängt es, wie leicht eingesehen werden
muß, unmittelbar zusammen, daß einer nur mit einem Bein
auferstehen wird, wenn er mit einem Bein gestorben ist.
In keiner Religion ist die Trennung zwischen Schöpfer und
Geschöpf so klar, so schneidend vollzogen wie in der
mohammedanischen. Den augenfälligsten Ausdruck finde ich davon
über alle islamitischen Länder verstreut in der ebenso
wunderbaren wie klaren und einfachen Architektur, wo Gotteshaus und
Grabmonument ein und dieselbe Form haben. Hier ist arm reich und reich
arm dank wiederum dem Satz Allah ist
Allah. Liegt, frage ich, nicht darin, in eben der Gleichheit, in
der Ähnlichkeit von Gotteshaus und den Tausenden von
Grabmonumenten, welche in wechselnder Größe wie nach
199
einem
Modell gearbeitet, von Gartenanlagen, spiegelnden Kanälen oder
Teichen umgeben, selten aus Marmor, meist aber aus Ziegeln verfertigt,
im Schatten von Terebinthenbäumen oder in verwüsteter,
verlassener Landschaft mitten unter Ruinen erhalten, den Boden Nord-
und Mittelindiens, der Natur sich nur widerwillig vermählend,
bedecken, liegt darin nicht die eindeutigste Verkündigung der
Nichtverwandlung ausgesprochen, vielmehr niedergelegt? Haben wir dann
nicht zuletzt auch das reinste Gesicht, das Antlitz selbst des
islamitischen Fatum oder die Spiegelung von dessen Idee? Wobei ich in
diesem, im Fatum, weiter den eigentlichen Ausdruck von der
Humanität, ja das ganze Humane, die Vernunft des Islams erblicke.
Wir Europäer, durch Jahrhunderte Leser Homers und der Bibel, sind
Logiker und Krieger, beides zusammen, Menschen also, die mit dem
Schwerte und mit Begriffen zu trennen und zusammenzufügen gelernt
haben. Einer kriegerischen Seele und einem mathematisch-logischen Kopf
wie Napoleon mußte darum der Islam als die sinnreichste Religion
erscheinen.
Ich gestehe, daß ich mich in Indien zu Beginn meiner Reise, die
mich vier Monate in Anspruch nahm, aus meinem Europäertum, aus
meinem Latinismus und Bibellesen heraus an diese klare Trennung von
Schöpfer und Geschöpf, wie die islamitische Kunst sie vor
allem in der Architektur offenbart, mit meiner ganzen Seele zu klammern
suchte, vor den ungewohnten Gebilden des Hinduismus
zurückscheuend, darin Schöpfer und Geschöpf in
Zerstörung und Erneuerung sich ewig durchdringen.
Die Kehrseite freilich der Erscheinung eben jener Angleichung von
Vernunft und Fatum, die Kehrseite des
200
sublimen
Entzugs der Freiheit, wie er sich in de Angleichung ausspricht, ist
eine gewisse Entwicklungsunfähigkeit alles Mohammedanischen, eine
deutliche Öde, womit sich islamitisches Wesen zu oft und allerorts
umgeben hat, weshalb der Islam zu wahrer Erhabenheit vielleicht nur in
der Wüste zu gelangen vermag. Auf was für Gegensätze ist
früher nicht der Reisende im Kaukasus oder an der Wolga
gestoßen, sooft sein Weg ihn aus einer blühenden deutschen
Ansiedlung in das zunächst liegende Dorf eines Tartarenstammes
führte?
8
Von Peshawur, im Nordwesten Indiens, wollte ich den Khyberpaß
besuchen, der nach Kabul führt und, da er die
Verbindungstraße zwischen Indien und Rußland bildet, von
den Engländern sehr streng bewacht wird. Der Weg galt damals und
gilt wahrscheinlich heute noch für gefährlich; Beweis
dafür war, daß die englische Regierung nur an einem einzigen
Tag der Woche die Verantwortung für die Sicherheit des Reisenden
übernahm. Am Freitag. Oder waren es zwei Tage, Freitag und
Dienstag? Automobile gab es derzeit in ganz Indien noch sehr wenige,
ich mietete mir darum eines der leichten und gut gefederten
Wägelchen der Gegend, daran zwei sehr flinke Araber zogen, wie sie
vom persischen Golf her von Händlern nach Indien gebracht werden,
und fuhr am frühen Morgen bei schneidender Kälte von Peshawur
ab. Auf dem Bock wie immer Ali aus Lucknow.
Wenn ich an Peshawur zurückdenke, sehe ich Häuser vor mir aus
gelbem Lehm an schnurgraden Straßen, kunstlose mit Kalk
bestrichene Moscheen mit Minaretten gleich Schornsteinen, ich rieche
Kamele, die zwei-
201
höckerigen,
zottigen aus Mittelasien, Schafherden, den oft knöcheltiefen,
weichen, lehmigen Staub der Straßen, das verbrannte Holz in der
Luft, nach welchem ganz Nordindien riecht, zumal am Abend. Die
Männer sind von weißer Hautfarbe, tragen dichte schwarze
Bärte, sind abweisend, von rauhem Gebaren, sehr männlich,
alles Kaufleute, Besitzer von Kamel- und Schafherden, auf Besitz
eingestellt und von der Verschwiegenheit des Besitzenden.
Ich habe stets achtgehabt auf die verschiedene Art, womit sich Menschen
auf Besitz einstellen und die je nach Rasse, Klima, Religion zu
wechseln scheint. Mein Freund Chaudhuri führte mich einmal in
Kalkutta durch schmutzige enge Gassen mit hohen Häusern, von deren
Mauern der Kalk abzubröckeln begann. Die Fensterscheiben waren mit
Staub und Spinnweben so bedeckt, daß das Licht kaum durchdringen
mochte. Hier wohnen, sagte er, lauter reiche Leute, Millionäre,
wie er sich ausdrückte, die ihre Schätze: Edelsteine,
Korallengeäst, Silberbarren, Gold, gemünzt und
ungemünzt, in ihren Kellern verstecken. Man würde sie, wenn
man ihnen auf der Straße begegnete, für Bettler halten, so
verwahrlost ist ihr Äußeres. Ihre Betten sind voll
Ungeziefer, und am Tage lassen sie Arme darin liegen, damit sich die
Flöhe und Läuse an diesen vollsaugen, sie selbst nachts dann
von ihnen Ruhe hätten und das Ungeziefer zu töten sich nicht
genötigt sähen. Sie dürften zum großen Teile der
Sekte der Jainas angehören.
Aus solchen Besitzenden mag dann ab und zu ein Verzichtender, der
Asket, hervorgehen. Ich kann mir aber keinen solchen unter den
schwarzbärtigen Männern aus Peshawur denken. Der Asket
möchte dort ebensowenig wachsen, wie der Apfelbaum oder die Linde
auf indischem Boden gedeiht. Wir haben hier dieselbe genaue,
202
nette
Abgrenzung zwischen Mensch und Ding, Mensch und Besitz, Mensch und
Tier, Mein und Dein, wie wir sie vorhin zwischen Schöpfer und
Geschöpf gefunden haben, dasselbe Fehlen des Überschwangs,
des Hinübergleitens von einem zu anderen. Ich stelle mir nebenbei
vor, daß es weder unter diesen Männern von Peshawur noch
auch unter den Bettlermillionären in Kalkutta so etwas wie den
Geizigen in unserem Sinn gebe, den Geiz als Sünde, den Geizhals
als Figur eines Schauspiels. Wer dort besitzt, ist damit schon geizig.
Der Geiz gehört zum Ding, das unser ist, ebenso dazu wie zu dem,
dem das Ding gehört. Im Geizigen europäischer Herkunft aber,
im Schauspiel oder in der Geschichte, im Roman des Geizigen haben wir
unter allen Bedingungen eines: den Kampf mit den Erben, den Konflikt
zwischen der deutlichen Lebensfeindlichkeit des Geizigen, vom Geiz
Ausgetrockneten und der Lebensfülle Liebender, solcher Verwandten,
die enterbt werden. Im letzten Sinne geht es hier um den Kampf zwischen
dem Einzelnen, der sich isoliert, und der Art, die sich propagieren
will und muß. Den kennt der Asiate, ob er nun Hindu oder Islamit
sei, nicht so, wie wir ihn kennen, weil er, der magische Mensch, der
magische Leib, der Mensch ohne ,seinen Widerspruch‘, den Weg aus dem
Kult in das Drama nicht oder noch nicht genommen hat oder nicht nehmen
kann. Diese Bettlermillionäre von Kalkutta sind in einem
kolossalen Ausmaße humorlos, und wir haben schon gesehen,
daß Humorlosigkeit im bestimmten Sinn zum magischen Leib
gehört. Ich bin nur froh, hier die Beziehung zwischen Besitz und
dem magischen Leib aufgedeckt zu haben. Ach, man muß alles
zusammenzusehen wissen, um für einen Augenblick wenigstens ganz
glücklich sein zu können.
203
Wir
fuhren zuerst in einer gegen das Gebirge zu abfallenden Ebene, die
ockergelb und sehr trocken war, durch Dörfer, daraus da und dort
Türme aus braunem Lehm ragten. Ich mußte an San Gimignano
denken, und die rauhe, rauchige Luft hier zauberte in mir für
einen Moment die Wein- und Feigensüße der Landschaft um das
toskanische Städtchen herum hervor, die ich Jahre vorher
gleichfalls in einem Wägelchen durchfuhr, wenn auch nur mit einem
Pferd und ohne Ali auf dem Bock. Von den Türmen der Dörfer
wird aus Löchern, Schießscharten dem Feind aufgelauert, dem
Nachbarn und Mann der Blutfehde, bis der Zeitpunkt oder die Gelegenheit
gegeben sind, daß man ihm leicht und sicher eine Kugel aufbrennen
kann. Dazu sind die Türme da, dazu ungefähr waren sie vor
Jahrhunderten auch in den Städten Toskanas und Umbriens dagewesen.
Vor uns lag das Gebirge, baumlos, rosa, violettes Gestein mit ab und zu
einem Smaragdstreifen darüber. Da die Sonne hochgestiegen war, war
alles grau geworden, bis es der Abend wieder in eine Landschaft aus
Edelsteinen verwandelte. Während wir den Paß in vielen
Schleifen anstiegen, traten von Zeit zu Zeit Wachtposten bewaffnet
hinter Felsen vor und sahen uns nach. Es sind Afridis, ein
kriegerischer Bergstamm, dem die Engländer die Bewachung des
Khyberpasses anvertrauen, die Söhne jener Männer, die sich
unten in den Dörfern von ihren Türmen aus totschießen.
Man kann den Engländern die Herrschergabe in keinem Fall streitig
machen.
Eine Biegung der Straße, und drei nackte Kinder, jedes mit einem
am Nabel baumelnden Amulett, weichen vor dem Wagen zurück, ein
etwa achtjähriger Knabe tritt vor die zwei kleineren, sie
schützend, schreit wie am Spieß und hält, am ganzen
Körper gespannt und bebend vor
204
Schrecken,
den rechten Arm gegen mich ausgestreckt, mit den Fingern der Hand das
Zeichen gegen den bösen Blick zu mir hin machend. Ich suchte ihn
zu beruhigen, indem ich ihm ein paar Annas aus dem Wagen warf, doch der
Knabe schrie noch heftiger, und sein schützender Körper
spannte sich in der Angst noch mehr vor den Kleinen auf, die keinen
Laut hervorbrachten. Ich habe nie ein Wesen so von bloßer Angst
gespannt gesehen. Doch einmal einen Maulwurf, den ich mit meinem Stock
auf seinem Gang durch die Erde zu unterbrechen suchte. Der war aus
Angst zu einer kleinen schwarzsamtenen schnurrenden Trommel geworden.
Reichlich vor der Mittagsstunde waren wir bei der Moschee des Ali
angelangt, wo wir unser Frühstück nehmen wollten, jeder
für sich. Obgleich mein Diener, wie erwähnt, Mohammedaner
war, würde er nicht einmal eine Banane aus meinem Eßkorb
angenommen haben. Mein letzter Diener auf der Reise, mit dem ich von
Ceylon nach Südindien übersetzte, war half-cast, Christ, und
wurde als solcher einmal aus einem Abteil dritter Klasse von
Eingeborenen einfach herausgelacht, so daß er in mein Abteil
stürzte und mich völlig Ohnmächtigen um Hilfe bat. Trotz
allem würde er, wenn wir zufällig einmal auf einer
Eisenbahnstation das Essen im selben Raum nehmen mußten, da es
weder ein Rasthaus, noch ein Hotel dort gab, sein Mahl nie anders
verzehrt haben als im Winkel der Stube, mit der Schüssel vor sich
hinkauernd und mir den Rücken kehrend.
Die indischen Speisevorschriften, denen sich alle Inder ohne Ausnahme
oder mit der einzigen Ausnahme der Parias unterwerfen, sind in enger
Verbindung mit der Kaste zu denken, und die Kasten wiederum mit der
Vorstellung vom magischen Leib. Die vier Hauptkasten der
205
Hindus,
die Brahmanen, die Kschatrias, die Vaischas und Çudras, sind aus
der Teilung des Leibes Brahmas entstanden; die Priester aus dem Haupt,
die Krieger aus den beiden Armen, die Kaufleute aus dem Rumpf, die
Handwerker und alles andere aus den Beinen. Damit ist die Relation der
Kaste zum magischen Leib ein für allemal fixiert worden. Das Essen
ist, möchte man sagen, ein Akt der Scham des magischen Leibes
gleich den anderen Akten der Entleerung, Zeugung, des Gebärens.
Wir Menschen Europas ,mit dem Widerspruch‘, wir Menschen des
Maßes haben ein für allemal eine Grenze gezogen zwischen
Oben und Unten (eben um des Widerspruchs, um des Maßes willen).
Nicht so der Mensch der Kaste und des magischen Leibes, der Oben und
Unten vertauscht. Das einzusehen ist von großer wichtigkeit
für den, der den Osten verstehen will.
Man hat in Europa seit dem 18. Jahrhundert, vornehmlich in den
Jahrzehnten des Liberalismus, die Idee der Kaste mißverstanden,
deren Sinn nicht oder falsch gesehen, und darum möchte ich hier an
dieser Stelle etwas Grundsätzliches darüber vorbringen: Wenn
wir das Kastenwesen oberflächlich beurteilen, möchte man
nämlich meinen, daß in der großen Anzahl der Kasten
bei den Hindus (man zählt ihrer über achtzig), in den
unzähligen und äußerst peinlichen Vorschriften der
einzelnen, alle Lebenslagen, Lebensumstände betreffend, eine
große Sensibilität zum Ausdruck komme, ein unendlich
verfeinertes Spüren der Dinge, Werte und Oberflächen. Die
genaue Wahrheit ist nun die, daß das Kastenwesen die ganze
mögliche Sensibilität, über die ein Mensch verfügen
möchte, eingezogen hat, bindet, in Regel und Form verwandelt und
im letzten Grund dann schwächt, wenn nicht tötet. So
daß man wohl sagen darf,
206
ein
ganz sicheres Kennzeichen des magischen Leibes sei Mangel an
Sensibilität. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Man
muß diesen Mangel spüren, sehen, riechen. Ärzte, die in
Spitälern zu tun hatten, haben mir ihn von ihrem Standpunkte aus,
einem rein biologischen, bestätigt. Pragmatistisch gedacht,
wäre die Kaste sogar als Mittel gegen allzu große
Sensibilität zu empfehlen. Wir Europäer, Menschen mit dem
Widerspruch, haben die Sensibilität entdeckt und gezüchtet.
In gewissem Sinn kam sie im 18. Jahrhundert auf, in jenem Jahrhundert
der Aufklärung, Humanität und Vernunft, das allem Kastenwesen
den Todesstreich versetzt hat. Man vergleiche einmal das 17. und das
18. Jahrhundert in Frankreich. Im 17. ist alle Sensibilität noch
Form, in der Form zurückgehalten und aufgehoben, im 18. ist Form
gelockert und die Sensibilität frei geworden.
Es scheint, daß ich meine Fahrt zum Khyberpaß nur
angetreten habe, um hier in einem fort davon abgelenkt zu werden. Ich
hatte, auf einem Stein mitten unter Geröll in Sonne sitzend, mein
Frühstück noch nicht beendet, den Eßkorb vor mir, als
plötzlich von der Paßstraße her eine ganze Schar von
Pathanen, Hunderte, Männer aus Kabul, auf mich zukam, die Kamele
und Tragesel zurücklassend. Sie kam, um in der Moschee oder vor
ihr das Mittagsgebet zu verrichten. Da Mohammedaner in der Nähe
eines so heiligen Ortes, wie es die Alimoschee unzweifelhaft ist,
leicht gereizt sind, so verzog ich mich, so rasch ich konnte, durch sie
hindurch, die schon die ganze Strecke von der Straße her
überschwemmt hatten. Auch hier fiel mir der Mangel an Neugier
seitens der Menschen des Ostens auf. Kaum, daß sie mich bemerkten
oder kaum, daß sie mich anders merkten, als etwa ein Dachs
bemerkt wird, der vom Wald her in den Förster-
207
garten
eingebrochen war und am Morgen den Weg nicht gleich herausfindet. Was
ich aber spürte, was ich roch, während ich mich durch die
gewaltigen, hochgewachsenen, ruhig einherschreitenden Pathanen
hindurchstahl — sie schritten langsam und ungefähr, wie Kühe
sich in den Alpen plötzlich über einen Abhang am Bach
verbreiten, überallhin, wo es etwas zu grasen gibt —, was ich also
sehr deutlich spürte, war der Geruch von Mannheit, von Geschlecht,
rein und unrein, wie Tiere zugleich rein und unrein sind. Wenn wir den
Mohammedaner der Idee des Fatum entkleiden, welches sein Menschentum
verkörpert, so bleibt das pure Geschlecht zurück mit allem
Geruch des Geschlechts. Diese Männer kamen von Kabul und zogen
gegen Peshawur. Drei Jahre später sah ich von Samarkand eine
Karawane demselben Pathanen mit zweihöckrigen Kamelen und Eseln
nach Kabul ziehen. Ist nicht Samarkand der Sitz jener theologischen
Fakultät gewesen, von wo das islamitische Dogma ausgegeben wurde,
daß die Frau keine Seele hätte?
9
Ich habe hier die Dinge so zu sagen, wie ich sie empfinde. Beim Anblick
der Parsees in Bombay, Männer und Frauen aus allen Altersklassen,
mußte ich jedesmal an die Geier denken, durch deren Leiber alle
toten Parsees seit Jahrtausenden hindurchgehen, ich habe dabei
Geierfleisch, das an den vom Gefieder entblößten Hälsen
und Beinen, gespürt, gefühlt, geschmeckt. Es ist nicht das,
daß die Parsees häßlich wären. Hat es doch auch
nicht viel Sinn, den Geier einfach häßlich zu nennen. Von
allen Vögeln der Erde hat er den schönsten Flug. Herrlich,
seinem Kreisen im Azur des Himmels hoch oben über dem Golf von
Bombay mit den Augen zu folgen.
208
Nein,
es geht hier nicht um Häßlich und Schön. Oder wenn
Häßlichkeit beim Parsee vorliegt, so ist das kein Begriff
und durchaus ohne den Gegensatz des Schönen zu denken. Wie das
beim Griechen statthat, der alles das in die Welt gesetzt hat:
Maß und damit im Zusammenhang den Gegensatz und Widerspruch. Was
wir hier bei den Parsees, unserer ersten Empfindung folgend,
häßlich nennen möchten aus unserem Griechentum heraus,
das uns ebenso angeboren wie anerzogen ist, ist eine tiefliegende,
besser: dem Ganzen entströmende Reizlosigkeit. Als objektiver
Ausdruck genommen für das, was ich eben Mangel an
Sensibilität des magischen Menschen, des magischen Leibes genannt
habe.
Das Magische liegt hier in einem bestimmten Mystizismus der Materie.
Die Elemente: Wasser, Erde, Feuer, dürfen nicht verunreinigt
werden. Darum wird der Leib des Toten den Vögeln vorgeworfen, was
die Hellenen Homers, Anbeter des Helios, nur mit dem Leib des
getöteten Feindes getan haben. Dürfen wir uns darüber
wundern, daß die Parsees aus dieser Vorstellung heraus das
vielleicht einzig und allein ganz unkriegerische, um den modernen
Ausdruck zu wählen: das eine aus seinem ganz gestockten Wesen
heraus pazifistische Volk auf Erden sind, daß ihnen die Divergenz
von Krieg und Frieden völlig abhanden gekommen sein müsse,
wenn sie diese jemals besessen haben? Daraus hat sich von selbst die
denkbar natürlichste Beziehung zum Geld ergeben als dem neutralen
Ding an sich, dem wurzel- und gestaltlosen, das irgendwie Feind und
Freund verbindet, indem es beides auslöscht: Feindschaft und
Freundschaft. Sind doch die Parsees die eigentlichen Bankiers von
Indien.
Es wäre trotzdem verfehlt, eine Verwandtschaft zwischen den
Puritanern und den Parsees in beider Beziehung zum
209
Geld
zu suchen. Jene der Puritaner zum Geld kommt von sehr weither, aber
geradenwegs vom Bibelgott, sie ist sehr geistig oder weist, wenn man es
lieber so haben will, auf einen ganz geistigen Gott zurück. Die
Beziehung des Parsees zum Geld ist die genaue Folge des von mir so
genannten Mystizismus der Materie. Ich möchte es darum so sagen:
Im Geld des Puritaners hat sich die Materie in pure Bewegung
verwandelt, im Geld des Parsees hat sie das Elementare, Elementhafte
verloren und ist zum reinen Symbol geworden.
Die ganze Welt dieser als Leichen den Geiern ausgelieferten Menschen
scheint mir reizlos, unblühend, gestockt: die Kleidung, die
entsetzlichen Hüte aus Wachsleinwand, die Kurzsichtigkeit im
Blick, ihre Wagen, alles. In den Berichten über ihre
Begräbnisse und Begräbnisstätten, auf die man
gelegentlich in den Zeitungen stößt, ist allemal die Rede
von den ,Türmen des Schweigens‘, weil das offenbar schön
klingt und ein Berichterstatter sich seine Reise nach Indien nicht hat
verderben wollen dadurch, daß er schön klingende Worte nicht
anbringt. Diese vier oder fünf an Größe verschiedenen
sogenannten Türme des Schweigens gleichen ebenso vielen
Gasometern, die oben offen sind. Sowie sich der Trauerzug mit der in
ein weißes Tuch gehüllten Leiche auf der Bahre einem der
Gasometer nähert, schwärmen hoch aus der Luft Hunderte von
Geiern heran und hocken oben am kreisrunden Rande des Gasometers hin,
sich ganz dicht aneinander drängend, Flügel an Flügel,
die vor Gier nach dem Fraß aufschlagen und sich senken. Sie
warten auf den Augenblick, da der letzte von den um die Leiche
bemühten Verwandten das Innere des Raumes verlassen hat. Woraufhin
sie sich auf den Leichnam stürzen und diesen innerhalb weniger
Minuten verzehren.
210
Das
Skelett zerfällt in kurzer Zeit unter den Strahlen der indischen
Sonne zu einem weißgrauen Pulver, das dann mittels einer
ingeniös angebrachten Ableitungsvorrichtung weggeschwemmt wird. Es
soll sich ereignet haben, daß ein Spaziergänger oder ein
Kind auf der Strandpromenade einen Finger oder eine Zehe findet, die
einer der auffliegenden Geier hat fallen lassen.
Noch das, bevor ich abschließe: die Parsees sind von
äußerster Sittenstrenge und Sittenreinheit. Es kommt nicht
vor, daß man einem Parseemädchen in einem der großen
Freudenhausquartiere des ganzen nahen oder fernen Ostens begegnet. Ich
kann nun nicht finden, daß der Puritanismus in diesem Fall nichts
mit der genannten Reizlosigkeit zu tun hatte.
Ich möchte noch einmal auf die Idee der Schönheit
zurückkommen, weil mir dort, wohin ich jetzt denke, die
Lösung des Problems: betreffend die Schönheit, betreffend das
Verhältnis des Ideellen zum Sinnlichen und so weiter, ganz offen
dazuliegen scheint. Es muß stets im Auge behalten werden,
daß Schönheit als Idee genommen von der magischen Welt in
deren ganzem Umfang ausgeschlossen bleibt. Wo sie darin zum Ausdruck
kommt, ist sie Schmuck und Ornament. Den Übergang, besser noch:
den ersten Schritt vom Ornament und Schmuck zur Idee macht das
Maß oder macht die Idee des Maßes, die griechisch ist. Mit
der Idee des Maßes haben wir oder hat die Menschheit die Welt der
Magie verlassen. Der magische Mensch ist ohne Gegensatz in sich, Mensch
des Maßes hingegen trägt den Gegensatz sich oder erzeugt den
Gegensatz aus sich oder ist dank dem Gegensatz erst ein Zeugender. Man
denke jetzt noch einmal an alles das zurück, was ich über den
persischen Schiffskapitän gesagt habe mit dessen zwei Ich oder mit
211
dessen
teilbarem Ich. Ich will mich nicht wiederholen und nur darauf noch
hinweisen, daß genau derselbe teilbare Mensch sich zur Religion
des guten und des diesem an Rang völlig gleichen bösen
Geistes, Ormuzd und Ahriman, bekennen muß und zu keiner anderen.
Weshalb auch die Religion der Perser in alter und neuer Zeit und mit
Recht stets als die eigentlich magische gegolten hat und ihre Priester
Magier hießen.
Wenn wir nun alles das bedenken und zudem nie außer acht lassen,
daß das griechische Maß gleichsam den Vorhof anzeigt zu
dem, was wir Einzeltum, Individualität nennen, so ergibt sich,
daß de Schönheit Asiens zunächst oder im Grunde
Schönheit der Art ist und nicht Schönheit des Einzelnen. Ich
bin in Bombay den unschönsten, ich bin aber ebendort auch den
schönsten Menschen, scheint mir, begegnet. Letztere waren Araber
aus der Gegend des persischen Golfes, Pferdehändler, Väter
mit ihren Söhnen. So hatte ich mich stets die Patriarchen, die
Erzväter vorgestellt. Gleich mir ergingen sie sich des Abends am
Strand, im gelben Burnus, darunter die braune Tunika, das mächtige
Haupt von der an den Hals sich eng anschmiegenden Kapuze
geschützt, so daß das bärtige magere Gesicht mit der
Adlernase, den vollen geschwungenen Lippen ruhigen Auges den Beschauer
ansah. Da sich die Sonne dem Horizonte näherte, um im Mehr
unterzutauchen, breiteten Diener ein wenig abseits von der
Menschenmenge gegen das schäumende Meeresufer zu die
Gebetsteppiche aus. Das Gesicht zum untergehenden Sonne hin gerichtet,
da genau dort Mekka liegt, knieten die Alten hin, neben ihnen zu
rechter und linker Hand auf kleineren Teppichen die beiden jungen
Söhne und in gemessener Entfernung hinter ihnen de Diener oder
Sklaven. Und so beugten sie die Häupter
212
und
richteten sich wieder empor zur Sonne hin und berührten den Boden
mit den Stirnen...
Schönheit war hier, noch einmal, Schönheit der Art, Sitte ist
Ordnung des Stammes. In dieser Schönheit der Art kommt auch das
zum Ausdruck, was ich eben für den Islam so bezeichnend gefunden
habe: die Trennung von Schöpfer und Geschöpf. Bevor sich
nämlich der Schöpfer von den Geschöpfen löst,
müssen in seinem Geiste die Arten bestanden haben, die Namen der
Arten, die Zahl der Arten. So ist es. Ohne die Art, ohne die Bestimmung
und das Gesetz der Art würde sich kein Geschöpf vom
Schöpfer haben trennen können oder wollen. Noch das:
Menschen, deren Gotteshäuser den Grabdenkmälern so gleichen,
wie sie es auf islamitischem Boden allenthalben tun, können an
keiner anderen Schönheit teilhaben als an der Schönheit der
Art. In der Schönheit des Einzelnen ist stets ein
Überfließendes, Überströmendes enthalten, eine
gewisse Exaltation und Romantik, die im engsten Zusammenhang mit der
Idee an sich steht. Und nur im Bereiche des Einzelnen kann dann ein
Unterschied gemacht werden zwischen der Schönheit des inneren und
der des äußeren Menschen oder kann von einer schönen
Seele im häßlichen Körper geredet werden, keinesfalls
aber im Bereich der Art. Wir kämen hier auf das zurück, was
vorhin über das Maß und den Gegensatz oder Widerspruch
gesagt wurde.
10
Nackt im Orient ist nur der Heilige, der Leib des Heiligen, des
Überwinders, ob es sich nun um Mohammedaner oder Hindus handelt.
In Sidi Okba,
einer Oasenstadt am Rande der Sahara, lief in den Basaren ein nackter
alter Mann herum ohne Lendentuch, das ent-
213
blößte
Geschlecht einer verschrumpften Dattel gleich. Ohne Turban. Das Haupt
war ungeschoren, das Haar glich einem jener Gestrüppe in den der
Wüste vorgelagerten grauen Steppen, an welchem jeder Araber, der
barfuß, auf trockener Sohle schreitend, auf langer Wanderung
vorbeikommt, allein oder als Glied einer Karawane, ein ganz kleines
Fetzchen Tucht heftet. Zum Zeichen dafür, daß er hier Allahs
gedacht habe.
Dieser nackte alte Mann war offenbar närrisch und galt für
einen Marabu, wie man dort die Heiligen nennt. Er wurde von den
Kaufleuten des Basars ausgehalten, er schlief, bei wem er wollte, man
gab ihm zu essen, und jeden Morgen wurde er in ein Hemd gesteckt, das
er sich dann vor den Augen der anderen vom Leib riß.
In der Lawra
zu Kiew, dem berühmtesten Wallfahrtsort der orthodoxen Russen,
sah ich zwei Bäuerinnen, de jede ihre Närrin mit sich
führte. Es sollte ein Opfer sein, eine Beschwernis des Pilgernden,
denn die Närrinnen benahmen sich wie ungezogene Kinder, schrieen,
verunreinigten sich, gaben das Essen wieder. Am Mariahimmelfahrtstag
sind in Cancale,
wohl überall in der frommen, mystischen Bretagne, Altäre
errichtet am Strand, davor Kinder, Frauen, Mädchen und wenige ganz
alte Leute beten, de Männer fischen weit draußen im Meer bis
Neufundland. Vor einem der vom Kerzenlicht erleuchteten Altäre
stand abends ein Schubkarren, darin ein Blöder lag, grinsend und
lallend. Im ersten Halbkreis um ihn herum knieten die Kinder, im
zweiten die Mädchen in ihren weißen Hauben, hinter diesen
die Mütter. Die wenigen alten Männer standen und bildeten den
Rand gegen die Zuschauenden zu.
Der alte Nackte in Sidi Okba war eine Art Maskotte und wurde als solche
von den Kaufleuten gehalten. So wie
214
sich
einer eine Puppe in sein Auto hängt. Er sollte den
dunkelhäutigen Männern in ihren schneeweißen Tuniken,
das geschorene Haupt mit dem Turban bedeckt, Glück bringen. Das
sollte er. Als Glücksbringer baumelte und hing er zwischen dem
Schöpfer und dem Geschöpf, zwischen Allah und den
Männern des Handels, Gewinns und der Zeugung. Er, der ganz arm,
ein Bettler war und nicht mehr zeugen konnte. Der Welt des Islams fehlt
die Ironie, fehlt das Paradox. Fehlt auch die Idee der Umkehr. Statt
dessen baumelt die Maskotte, wechselt das Glück und füllen
die Gestirne den Abgrund aus zwischen dem Menschen und der Gottheit.
Man kann auch sagen, daß hier das Glück den Menschen erst
komplettiere. Ein Mensch ohne Glück wäre unvollkommen, es sei
denn, daß er sich in einen nackten Heiligen verwandelt habe, in
einen Narren, der täglich sein Hemd zerreißt. Nebenbei ist
nur in einer Welt des Glücks die Gleichung zwischen dem Heiligen
und dem Narren zu vollziehen. Sowie wir das Glück streichen,
fällt der Narr vom Heiligen und der Heilige vom Narren ab.
Der magische Mensch, der magische Leib ist ohne Ironie, ohne Paradox,
weil er ohne Gegensatz und Widerspruch ist. Und so ist er
glücklich oder unglücklich, hat er Glück oder
Unglück. Oder ist er abgeschlossen, begrenzt durch sein
Glück. Und nur so gehört sein Gestirn zu ihm oder kann er von
seinem Gestirn nicht los oder davon abfallen, wie eine Frucht vom Baum
abfällt, daran sie gereift ist.
An ihren Früchten sollt ihr sie
erkennen: gilt der Satz von den ,Glücklichen‘, kann er von
ihnen gelten? Das Evangelium kennt den Glücklichen nicht. Es ist
wundervoll und ein großer Trost, von hier aus über
Glück und Unglück in dem deutlich bestimmten Sinn nachdenken
zu
215
dürfen.
Stets liegt dem Glück eine magische Vorstellung zugrunde, was so
viel bedeutet wie, daß die Idee der Freiheit geleugnet oder
übergangen ist. An ihren
Früchten sollt ihr sie erkennen — diesem Satz setzt
irgendwie schon den freien Menschen oder besser: eine Welt der Freiheit
voraus. Darin liegt auch seine besondere Bedeutung.
11
Die lebhafteste Erinnerung führt mich zurück nach Thanessar.
Am Rande von Rajputana gegen das Penjab zu. Da ich, wie schon
erzählt wurde, an einem bestimmten Tage in Kapurthala sein
mußte, blieb mir nichts anderes übrig, als von Jaipure
kommend, Udaihpur zu überschlagen, was mich freilich heute noch
schmerzt, sooft ich daran denke, aber nach Thanessar wollte ich, koste
es, was es wolle. Ich wußte davon nur, daß es eine der
heiligsten Stätten Indiens und daß diese der Erinnerung an
die große Schlacht der Pandusöhne im Mahabaratham geweiht,
daß es die Landschaft Arjunas und Krischnas und der Bhagawadgita
sei, welche mir wenige Jahre vorher Houston Stewart Chamberlain in der
lateinischen Übersetzung von August Wilhelm Schlegel in die Hand
gelegt hatte, damit ich auf diesem königlichen Wege in die Welt
des indischen Idealismus eindringe. Ich fuhr in einer Tonga von zwei
Zebus gezogen von der Station aus in die kleine Stadt, welche noch ganz
den Charakter der Rajputenstädte bewahrt: die Straßen sind
nach den Handwerken genannt oder bestimmt, die darin geübt werden.
So gibt es eine Straße der Gerber, der Schmiede, der Weber, der
Müller und so weiter. Ich sehe noch, wie in den offenen Läden
der letzteren die Getreidekörner zwischen zwei Mühlsteinen zu
Mehl langsam zerrieben wurden. Da in Thanessar keine Engländer
leben, so gibt
216
es
kein Kantonnement in der Nähe der Stadt, dieser eine Meile weit
vorgebaut, wie das überall in Indien der Fall ist, wo
Engländer, Zivilbeamte, eine Garnison zu treffen sind. Statt
dessen gab es ein Rasthaus, darin ich abends mit einem englischen
Steuereintreiber zusammen mein Diner nahm. Dieser reist von Stadt zu
Stadt, von Dorf zu Dorf, unter seinem Gepäck ein Grammophon, auf
dem er sich heute abend beim Kleiderwechseln die ,Lustige Witwe‘
vorspielen ließ.
Ich fuhr durch Thanessar durch und gelangte bald an einen See, an
dessen Ufer ein Hindutempel aus weißem Marmor steht. Der See
endet im Westen in ein schilfiges Gelände, dem scheinbar eine
kleine, dunkelgefärbte Insel vorgelagert ist, die, wenn man lange
hinsah, sich bewegte, da und dort aufriß und wiederum zuging. Es
war in Wirklichkeit keine Insel, sondern ein breiter Haufen von dicht
aneinander gedrängten dunkelgrauen Sumpfvögeln, vielleicht
Reihern, Bläßhühnern. Das war nicht auszumachen. Vom
Tempel führten Marmorstufen ins Wasser des Sees, und darauf
saßen ohne Ordnung verstreut nackte Greise, barhäuptig, die
Schädel in der Sonne wie Kupferkessel leuchtend, jeder vor sich
einen alten mächtigen Folianten aus Pergament, darauf de Zeichen
einer großen fremden Schrift für mein Auge deutlich
erkennbar waren. Neben jedem der Greise stand die Trinkschale aus
Messing, ohne welche kein Hindu zu finden ist, und um die Greise herum
schritten oder saßen Affen. Einer davon hatte sich dicht an einen
der Greise herangedrängt und blickte mit ihm zugleich in den
Folianten. Mitten durch sie liefen die Stufen auf und ab die indischen
Eichhörnchen, hüpfte der sehr solitäre indische Star.
Die Tiere waren ohne Scheu vor dem Menschen wie im Paradies. Die Luft
war lautlos. Vielleicht drang dann
217
und
wann ein Vogelgekreisch oder der Laut aufflatternder Flügel von
der Vogelinsel her am jenseitigen Ufer. Es war sicherlich das erste
Mal, seitdem ich indischen Boden betreten habe, daß ich nicht den
pfeifenden Schrei der indischen Bussarde hören mußte, der
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang die Luft durchschneidet und in
mir immer den Eindruck eines zugleich Wilden und Traurigen
hinterließ. Als ich ein paar Jahre darauf im
,Falkenwäldchen‘ bei Moskau fuhr und derselbe oder ein sehr
ähnlicher Vogelschrei an mein Ohr drang von den zahllosen Falken
daselbst, sah und roch und hörte und schmeckte ich im Augenblick
asisches Land, asische Art und Wildheit, asisches Weh.
Ich stand wie verzaubert im Bezirk des Tempels von Thanessar und
rührte mich nicht vom Ort, bis daß es Abend geworden war.
Dabei hatte ich das Gefühl, daß ich weder für die
heiligen Männer noch auch für die Tiere um sie herum
vorhanden sei. Mir war, als ob ich davon verzaubert dastand, daß
sie mich nicht sähen.
Auch de Nacktheit dieser Greise war nicht griechisch, sondern die
magischer Leiber, doch schien mir ihr Sinn sehr verschieden vom Sinn
der Nacktheit des heiligen Narren von Sidi Okba. Die Leiche des
Islamiten wird in die Erde gelegt werden, die Greise von Thanessar
kehren, nachdem der Tod eingetreten, zur Sonne zurück im Feuer,
darin ihre Leiber verbrannt werden. Abends bei untergehender Sonne am
Ufer heiliger Ströme.
Eine andere Vorstellung von Glück haftet an beidem: an der
Rückkehr des Leibes zur Erde und an der Verbrennung. Vom
Glück des Narren von Sidi Okba habe ich alles gesagt, was zu sagen
ist. Glück ist hier, oder Glück herrscht, weil Schöpfer
und Geschöpf sich nicht berühren. Glück stößt
uns jetzt zu, überfällt uns, bewegt sich
218
im
Zwischenraum. Glück ist darum stets auch an ein
Äußeres, an ein Außen gebunden, an den Leib, an den
Erfolg. Die mögliche, die äußerste Verinnerlichung des
Erfolges, des Außen hat erst in der Erwählung oder, wenn man
will, in der Zahl der Erwählten statt.
Das Glück der Heiligen von Thanessar aber liegt zunächst
darin, daß das Geschöpf und der Schöpfer keine Grenze
gegeneinander haben und ineinander übergreifen. Mit anderen
Worten: Glück ist hier, daß wir nicht aus der Gottheit
fallen. Ebensowenig, wie die Planeten aus dem Bezirke oder aus dem
Gravitationsfeld der Sonne zu fallen vermögen. Glück ist also
nicht mehr an die Zahl gebunden. Ist es aber darum schon Innerlichkeit?
Die Frage muß so gestellt werden, und die Antwort lauten: Nein.
Oder so: dieses Glück ist noch äußere Innerlichkeit.
Und genau das ist Magie, Reich der Magie, magische Welt: das, was ich
äußere Innerlichkeit nenne, Seligkeit des Glücklichen,
Sonnen- oder Sternenlicht des Geistes. Zuletzt läuft alle Magie in
Metaphorik aus, in Bildlichkeit.
Eine kurze Zwischenbemerkung: Der europäische Realismus im
weitesten Sinn und magische Kunst schließen einander aus. Die
übertriebene, ans Groteske streifende Metaphorik der Dichtkunst in
Asien, vornehmlich in Indien, ist dort aus dem magischen Boden
emporgeschossen. Wenn es in der Buddhalegende heißt, daß
der Erleuchtete als weißer Elefant in den Leib seiner Mutter
eingezogen ist, um sich von ihr gebären zu lassen, so haben wir in
einem beides: Magie und Metaphorik. Davon könne eine ganze
Ästhetik ausgehen.
Ich habe in Indien erst das Heidentum begreifen gelernt. Ich habe dort
erst aus der lebendigsten Anschauung gelernt, was das eigentlich
heiße, wenn einer sagt: das
219
Heidentum
sei ohne Innerlichkeit im letzten und tiefsten und einzigen Sinne. Ohne
jene spezifische Innerlichkeit also, darin die ,Freiheit
des Christenmenschen‘ wurzelt. Alle Bücher, die ich vorher
über indisches Wesen gelesen hatte, wissen davon nichts. Ich habe
meinen Indischen Idealismus
nicht mehr auflegen lassen, weil auch darin nichts davon gewußt
wird. Schopenhauer ahnt ebenfalls nichts von dem, was ich
äußere Innerlichkeit oder Magie oder magischen Leib nenne.
Hier liegt der Unterschied zwischen dem Buddhismus und dem Christentum,
genauer: zwischen dem Gottmenschentum Buddhas und dem Gottmenschentum
Christi.
Im Gottmenschentum Buddhas steckt noch Magie, noch das, was ich
äußere Innerlichkeit nenne. Ohne diese Magie würden
hier Gott und Mensch nicht zusammenhalten oder müßten sich
voneinander lösen. In gewisser Hinsicht ist darum das
Gottmenschentum Buddhas leicht, ja der Inbegriff des Seligen selbst und
verlangt eines nicht: den Glauben. Das ist ein Ungeheures. Ganz Asien
kennt ihn nicht: diesen Glauben im Sinne der vollkommenen
Innerlichkeit. Wie das Gottmenschentum Buddhas von der Magie, so lebt
das Gottmenschentum Christi vom Glauben als dem ganz reinen, als dem
supremen Ausdruck der Innerlichkeit. Nur dank dem Glauben oder mittels
desselben fallen wir dann nicht aus der Gottheit oder fallen wir nicht
von der Gottheit ab, und insofern allein und auf keine andere Weise ist
dann auch der Glauben Glück und Glück weiter die Seele selbst
oder deren tiefste Regung.
Buddhgaya, nicht weit von Benares gelegen, im Dreieck der
Buddhalandschaft Nordindiens die östliche Spitze bildend, wenn wir
in Kapilavastu,
Buddhas Geburtsort,
220
die
nördliche, in Benares die westliche Spitze des Dreiecks sehen,
Buddhgaya also ist der berühmteste Wallfahrtsort der Buddhisten,
hierhin kommen sie von ganz Asien. Buddha empfing daselbst, unter dem
indischen Feigenbaum sitzend, die letzte Weihe der Erleuchtung. An
einem Teich, der mit Lotosblumen bedeckt ist und in den die Priester
und Frommen Marygold, die Opferblume Indiens, werfen, so daß das
Wasser die Farbe einer Jauche gewinnt, genau so wie der Ganges in
Benares, steht ein Schrein, welcher die uralte Statue des sitzenden
Buddhas, bekränzt gleich einem indischen Gott, birgt. Über
den Schrein schattet der indische Feigenbaum, aus dem alten gezogen,
unter dem die Erleuchtung vor mehr als zweitausend Jahren über den
lebendigen Sakhyasohn gekommen war. Ich sage, daß über die
Statue ein Kranz von Blumen — war es Jasmin, war es Marygold? — von den
Schultern herab zum Nabel hing wie bei einem indischen Gott. In der Tat
gilt hier Buddha für einen Avatar, eine Wiedergeburt und
Verwandlung Wischnus. Und als ich vor ihn hintrat, empfing mich kein
buddhistischer Mönch, sondern ein Wischnupriester, auf der Stirn
das Zeichen der Angehörigkeit zu dieser gewaltigen, über ganz
Indien hin verbreiteten Sekte der Wischnuiten.
Jetzt möchte ich etwas sagen, was ich damals freilich noch nicht
wußte, wie ich heute es zu wissen glaube, was ich vielleicht
nicht einmal ahnte, was sich aber trotzdem vom Anblick, von den
Gesichten der Buddhagegend, die ich mit Eifer, ja mit einer gewissen
Inbrunst besah, in den vielen Jahren, die seitdem verflossen sind,
nähren konnte.
Für das Gottmenschentum Christi ist es ganz wesentlich, daß
es unter gar keiner Bedingung als Avatar, als die
221
Wiedergeburt
einer bestimmten göttlichen Wesenheit gelten konnte und kann.
Daher der Glaube, daher weiter auch die Schwierigkeit des Glaubens, das
beinahe Übermenschliche desselben. Die Frage ist einmal so zu
stellen, ob der Glaube an einen wiedergeborenen Gott, an die
Verwandlungen eines Gottes noch Glaube im Sinne der Innerlichkeit, ob
er nicht etwas wie erstarrte Einbildungskraft sei. Diese Fragestellung
wird nur der ganz verstehen und beantworten können, der Einsicht
genommen hat in meine genaue Unterscheidung von Glauben und
Einbildungskraft (Über die
Einbildungskraft).
Auch dem Gottmenschentum des Dionysos gegenüber ist der Glaube
nicht Glaube, sondern Einbildungskraft. Nur für diese, zur
Einbildungskraft hin, möchte ich sagen, ist Dionysos
Verführer. (Weshalb in seinem Gefolge alles zu finden ist, nur
nicht eine Figur wie der Teufel oder Mâra,
der indische Todesgott, welcher Buddha zu verführen sucht.) Wir
können wohl dem
Verführer, wir können aber nicht an ihn glauben. Der Christ
glaubt an Christus.
Geschichtlich gesprochen ist Christus der letzte Gottmensch, und es
scheint mir ganz wichtig, daß auf ihn keiner mehr folgen wird,
keiner mehr folgen kann. Wenn auf ihn noch einer folgte, so würde,
wie gesagt, der Glaube nicht mehr Glaube, sondern Einbildungskraft
sein. Das ist das eine, unsere Einstellung zu ihm betreffend. Das
andere ist, daß damit, mit dem Umstand, daß Christus der
letzte Gottmensch war, unendlich viel mehr als das bloß
Zufällige einer geschichtlichen Tatsache behauptet wird. Sondern
damit wird angezeigt, daß Christus, der Gottmensch, und mit ihm,
durch ihn die Menschheit aus der Welt der Magie, des magischen Leibes
in die der Freiheit getreten ist. Und innerhalb dieser
222
Welt
der Freiheit gibt es ebensowenig Verwandlung, wie es unmöglich
ist, daß die Ströme der Erde vom Meere her
zurückzufließen vermöchten.
Ich komme noch einmal auf Dionysos zurück. Zwischen den magischen
Göttern, Avatars und Gottgeburten Asiens, zwischen Magie und
Freiheit, steht er, der Sohn des Zeus und einer irdischen Frau, im
Blitz gezeugt, in der Mitte, steht der Rausch, steht der Gott im
Menschen, die Verborgenheit Gottes im Menschen, das Göttliche in
der Menschenrede, steht das Bild, Bildrede, Bildlichkeit, Bildform, als
eigentlicher Ausdruck des Menschentums, steht das Gleichnis, die
Analogie und Ähnlichkeit zwischen Göttlichem und
Menschlichem, im letzten und tiefsten die Einbildungskraft und nicht
der Glaube, steht die Dichtung und steht die Kunst. Von hier aus erst
kann die Stellung der Kunst eingesehen werden, welche sie in der
magischen Welt, in der Welt des Maßes und in jener des strengen,
des schwierigen Glaubens einnimmt. Nur in der Bildwelt des Maßes
bedeutet die Kunst ein autonomes Reich, ein Zwischenreich, nicht so in
der magischen und nicht in der Welt der reinen Innerlichkeit des
Gläubigen.
12
Es war wenige Jahre vor dem großen Kriege in Petersburg, wie es
damals noch hieß. Mein inzwischen in Peking verstorbener Freund Baron
Staël, dem ich noch zu seinen Lebzeiten in der Figur gleichen
Namens des ,Aussätzigen‘ (in dem Buch Die Chimäre) ein Denkmal
setzen durfte, hatte, da er Orientalist an der Petersburger
Universität war, als Dolmetsch zu dienen einem Abgesandten des
Dalai Lama an den Zaren. Dieser kam aus Lhassa, war zuerst zu Pferde
mit einem Diener oder Alumnen, streckenweise zu Fuß, viele Wochen
lang bis Kokand
223
an
der chinesisch-russischen Grenze gereist, hatte dann in Taschkent die
russische Eisenbahn erreichen können und war von dort im
Salonwagen sechs Tage lang bis nach Petersburg gefahren. Der Diener
kochte für ihn den Reis und bereitete den Buttertee, den alle
Tibetaner trinken und der in den Dörfern und Städten an
Plätzen und Straßenkreuzungen neben Gebetmühlen oder
Gebetfahnen gekocht wird, wie bei uns Kartoffeln oder Äpfel
gebraten werden. Der Gesandte fuhr mit einer kleinen Buddhastatue, die
er selbst trug und nicht der Diener. Er ließ sie so wenig aus den
Händen wie die Mutter den Säugling. Er wußte nichts von
den Ländern, durch die er fuhr, er wußte nichts von den
vielen Grenzen, die er reitend, gehend, fahrend zu überschreiten
hatte. Er sah nichts, er sah auch nicht, wie an der Grenze von Asien
und Europa, bevor der Reisende sich der Wolga nähert, das Kamel
den Holzpflug des Kalmücken mit der Fuchsmütze zieht, wie
aber eines Morgens statt des Kamels eine Kuh oder ein kleiner Klepper
da sind und ein bärtiger Mann in roter oder blauer Bluse und hohen
Stiefeln hinter dem gleichen Holzpflug des russischen Bauern, ihn
festhaltend und lenkend, durch die lockere Erde schreitet. Er hatte
nichts von der ungeheuren Berglandschaft am Beginn seiner Reise
gesehen, nichts von den Hochebenen mit Yakherden, von der Steppe, von
den Baumwollpflanzungen und Fruchtgärten Turkestans, vom
großen Strom und der Brücke, über die er fuhr, nichts
von den vom Sturm der Ebene wie hingelegten schiefen Hütten in den
Dörfern der russischen Ebene, nichts von den bunten Kirchen aus
Holz am Rande endloser Wälder. Er sah weder nach rechts noch nach
links, sondern in sich hinein, als ihn, der den Buddha nie aus den
Händen ließ, die Hofequipage vom Nikolaijewski-Bahnhof nach
dem
224
Hotel
Europe brachte, in dem für ihn auf Rechnung des Zaren eine Flucht
von Zimmern reserviert war. Baron Staël begleitete ihn dahin, der
Abgesandte trat ein, und das erste und eine, was er nun tat, war,
daß er den kleinen Buddha auf ein Tischchen stellte, das der
Tür zunächst stand, davor auf den Boden fiel und dem
Erleuchteten dafür dankte, daß er ihn so sicher des langen,
langen Weges geleitet habe, von dem er ganz und gar nichts vom Anfang
bis zum Ende gesehen. Er wurde zum Zaren geleitet und war vorher dem
Minister des Äußeren vorgestellt worden. Vor dem Zaren
berührte er mit der Stirn den Boden und sagte, den Blick nach
innen gerichtet, die Worte her, die durch den Dolmetsch zu
übersetzen waren, und vernahm durch diesen die Antwort, welche der
Zar für ihn vorbereitet hatte. So wie er gekommen war, fuhr er
wieder von Petersburg ab. Ich sah ihn am Bahnhof, wo Staël auf
mich hinwies und meinen Namen nannte. Um die Hand hatte er den
Rosenkranz geschlungen, der aus hundertundacht Perlen besteht,
entsprechend den hundertundacht Arten der Fesselung durch die
Sinne.¹ Er sah mich, und er sah mich nicht. Seine Augen waren
keine Spiegel, sondern Sterne. Das waren sie. Und so blieb an ihnen
nichts haften, wie am Gestirn nichts haften bleibt und das Gestirn also
seine Bahn hat und dahinrast, weil nichts daran haften bleibt. Er
lächelte ein wenig, er hatte aber schon vorher gelächelt, er
lächelt, sooft ein Mensch in seine Nähe tritt: um der Bahn
willen und nicht aus Überlegenheit, wie die Araber wollen,
daß
¹ Die Islamiten Syriens tragen Rosenkränze
mit 33, 66 oder 99 Perlen. Diese bedeuten aber die Eigenschaften
Gottes, deren Anzahl wohl nicht ganz festzustehen scheint. Man kann den
Unterschied der beiden Religionen nicht besser kennzeichnen als mit
dieser so verschiedenen Bedeutung der Perlen des Rosenkranzes.
225
der
Mahdi, der Gottesstreiter, der Sieger, lächeln soll. Das
Lächeln des Mahdis, ohne welches ihn die Gläubigen nicht
sehen sollen, gleicht einem Schild, darin die Strahlen, die
tötenden, des einen, unendlich fernen und mächtigen Gottes
aufgefangen und milde geworden erscheinen, so daß der Mensch
daran nicht verglüht; das Lächeln des Mannes aus Lhassa, des
Buddhisten, dem die Vorstellung von dem einen Gott der Semiten ganz
fremd ist, war anders, war genau so wie das Geflimmer eines Sternes in
der Nacht, war das Lächeln des Menschen, dessen Auge verlernt hat
durch Jahrtausende, haften zu bleiben an den Dingen des
äußeren Lebens: um der Bahn willen. Dieses Auge ist ganz und
gar das des magischen Leibes, der ohne Pause von Verwandlung zu
Verwandlung schreitet und nicht in dem lebt, was wir Natur, Landschaft,
menschliche Gemeinschaft, Einsamkeit des geselligen Menschen und so
weiter nennen.
Ein Deutscher, mit dem ich im Hotel in Benares zusammentraf,
erzählte mir, er sei auf der Fahrt von Bombay nach dem Norden auf
dem Mount Åbu gewesen, auf dem sich die berühmten Jain-Klöster
befinden. Während er, Pflanzen sammelnd und Beobachtungen machend,
um die mächtigen Klostergebäude herumstrich, sei ihm
plötzlich aufgefallen, wie aus geringer Entfernung ein Mönch
im gelben Mönchsgewande ihm und seinen Schritten aufmerksam
folgte, ja beides mit dem Blick förmlich zu fixieren suchte. Der
Deutsche habe sich aber dadurch nicht irremachen lassen und weiter am
Boden nach Pflanzen Ausschau gehalten. Nur noch einen Blick wollte er
auf den Mönch schnell werfen ... Da war dieser verschwunden, wie
weggehoben vom Boden, auf dem er gesessen hatte. Der Deutsche habe nun
nichts anderes gedacht, als daß der Mönch sich hinter einen
der vielen Felsblöcke ver-
226
zogen
habe. Doch im Nu habe er wieder da gesessen, genau an derselben Stelle,
in derselben Haltung, nur habe er ihn jetzt nicht mehr fixiert, sondern
so vor sich hin und in sich hineingesehen, als sei weit und breit kein
Fremder, kein menschliches Wesen und als wäre niemals eines da
gewesen.
Ich habe wohl die meisten Tricks der Gaukler in Indien gesehen, die
dort zu sehen sind: den Korbtrick, Ropetrick, den Mangobaumtrick. Im
allgemeinen interessieren mich Tricks nicht. Ich bin auch gar nicht
geschickt darin, wenn es gilt, sie zu erklären, und versuche es
nicht. Sie scheinen mir nur soweit wichtig und bedeutsam, als ich sie
mit dem magischen Leib, als dessen Äußerung und Tat, in
Verbindung bringen kann. Mit dem magischen Leib und infolgedessen auch
mit dem Mangel an Sensibilität, welcher diesen, wie gesagt,
kennzeichnet, mit dem damit verbundenen Un-Begriff von der Natur. Diese
ist Illusion und kann nur Illusion sein. Es kam dem Mönch auf dem
Mount Åbu nur natürlich vor, da sein Blick heraustrat aus
dem Inneren, darin er meist verborgen liegt wie die Schlange in der
Ritze einer alten Tempelmauer, und des äußeren, des fremden
Lebens habhaft werden wollte, sich unsichtbar zu machen vor dem Auge
des Fremden. Wer wird sich nun darüber wundern, daß einem
solchen Menschen in seiner magischen Welt eines völlig fehlen
müsse: die Neugierde, die Neugierde des Europäers! Darin man
wohl, wenn man will, die allergröbste Form der Sensibilität,
ja den gemeinsten Ausdruck derselben, direkt eine Verhärtung
davon, sehen mag.
Ich kam abends mit dem Dampfer von Kalkutta in Rangoon an und machte
mich gleich nach dem Diner, das wie zumeist in den Hotels dort sehr
schlecht war,
227
nach
der Shve-Dagon
auf, einer der größten und berühmtesten Pagoden in
Asien. Es war schon Nacht geworden, als ich die sehr lange Treppe
hinaufging, an Schreinen vorbei, darin vor blumenbekränzten
kleinen sitzenden Buddhas Lichter brannten. Es war ein wenig
mühsam, da die Stufen — wohl mehr als hundert — ausgetreten waren,
glitschig von faulenden Blumen, welche die Frommen fallen ließen,
und den Körnern des Opferreises, die hier schon und oben um den
Tempel herum überall verstreut waren. Als ich oben anlangte, war
kein Mensch zu sehen, kein Menschenlaut zu vernehmen. Ein Schakal lief
gerade vorbei, als ich die letzte Stufe genommen hatte. Es soll
vorkommen, daß ein Leopard sich hier gelegentlich einen der
umherirrenden Pariahunde holt. Hunde sind die Lieblingsspeise der
Leoparden. In der Regenzeit muß man, muß sich der
Eingeborene mit seinen nackten Sohlen vor der Russell-Viper in acht
nehmen, die um Rangoon sehr häufig und wie alle Vipern ein
Nachttier ist. Gleich rechts von der letzten Stufe fiel mir ein
gedeckter Tisch auf mit allerhand Dingen zur Nahrung und Bekleidung des
Menschen: Eier, ein Huhn, Schälchen mit Reis, Bananen, ein
Stück gelben Tuches, gefaltet, ein Rasiermesser. Das ist alles
für die Mönche gedacht, wenn sie des Morgens in den Tempel
kommen. Der Mönch ist in Birma das, was bei uns der Soldat ist.
Das will bedeuten, daß jeder Mann, wenn auch nur für eine
Woche, Mönch gewesen sein, als Mönch gedient haben
müsse. Im bürgerlichen Leben führt die Frau das
Regiment, der Mann ist schwach, kindlich, ein Spieler, in der
Geschichte und Politik immer nur schwer sich der Intrige entwirrend. In
Bhamô, nahe der
chinesischen Grenze, war ich mitten im Volke Zuschauer bei jenen
Marionettenspielen, die überall in Birma in den Voll-
228
mondnächten
stattfinden. Als ich lange vor dem Morgen die Menge verließ, war
wieder ein Tisch vor dem Eingang in den Raum der Gaffenden aufgestellt
und mit solchen Dingen gedeckt, wie sie die Mönche brauchen. So
ist das Mönchstum eingewoben in das Leben der Tätigen und
Freudigen. Der Buddhismus hat keine Priester. Mir fällt jetzt ein:
Verhalten sich Priester und Mönch zueinander nicht wie Vorsehung
und Bahn? Die Vorsehung ist des Priesters, die Bahn des Mönches.
So fühlt man letzteren in Birma überall. Wo man ihm fort und
fort begegnet: allein, in Scharen, in der Eisenbahn, am Fluß, von
Haus zu Haus wandernd mit der Bettelschale, die mit einem
dunkelkirschroten Tuch zugedeckt ist: als den Menschen der Bahn. Wir
Menschen Europas, in den Vorstellungen des Monotheismus auferzogen,
wissen nicht, was Bahn heißt. Wenn wir das Wort gebrauchen, so
reden wir wie so oft herum. Eines steht fest, daß dort, wo Bahn
ist, noch etwas vom magischen Leib zurückgeblieben ist. Die Idee
der Vorsehung hingegen trinkt und saugt alle Magie auf wie die Sonne
den Tau der Nacht.
Dünne Drähte sind oben in Manneshöhe durch die Luft
gezogen von einem Ende des enormen Tempelbezirkes zum anderen, an
welchen Tausende von winzigen rechteckigen Messingplättchen
befestigt sind, die in der Nachtluft zittern und schwingen und klingen.
Und in dieser Sphärenmusik um die große, goldene Pagode
herum, deren Spitze hoch in den Himmel ragt, liegen, stehen und sitzen
in Schreinen, von diesen, vergoldet, blau oder gelb angestrichen, aus
rohem Holz geschnitzt, Hunderte von Buddhas gleich riesigen Puppen mit
großem Puppenlachen in der klirrenden Nacht.
Ich habe von früh immer das eine gedacht: wie Mensch und Gestirn
zusammen sind, wie Mensch und Gestirn
229
auseinander
sind. Dank der Vorsehung erhebt sich der Mensch vom Gestirn weg und
gerät in Länder und Gebiete jenseits aller Gestirne und
Sonnen, in die Länder und Gebiete eben jener reinen Innerlichkeit
des wahrhaft Gläubigen. In den Buddhas, die hier umherlagen,
umhersaßen oder standen, waren um der Bahn willen Mensch und
Gestirn zusammengekommen und geeint, und zwar so wundervoll, daß
es schien, als wandelte ich in einem Himmel, der eingestürzt war,
und als stieße ich an erloschene Sonnen an.
13
Ich komme noch einmal auf den Unterschied zwischen dem Nackten des
griechischen und dem des magischen Leibes zurück. Ersteres
bedeutet Maß, Natur, im letzten Einzeltum und
Individualität. Das Nackte des magischen Leibes ist im
Kastenmäßigen eingehüllt, ist gewissermaßen
dessen Fruchtkern. Darum ist der Heilige nackt. Er steht über den
Kasten. Er allein und niemand anderer ist der Einzelne Asiens.
Ich möchte im Anschluß daran jetzt etwas sagen, was die
meisten überraschen, viele vielleicht verletzen wird: das
Unschöne, das Wort muß heraus: die sinnlose
Häßlichkeit des verehrungswürdigen Ghandi
geht für mich im Grunde darauf zurück, daß er zwei
Dinge vermischt hat, die nicht vermischt werden dürfen: den
Einzelnen und den Heiligen, die Nacktheit des natürlichen und die
des magischen Leibes. Es ist bestimmt so, wie schwer es auch immer
für einen bloß räsonierenden Geist sein mag, sich diese
Ansicht zu eigen zu machen.
Ich erinnere mich in diesem Augenblick eines wundervollen, ja erhabenen
Bildes draußen in den Malabar Hills, der Gartenvorstadt Bombays.
In einem Garten vor einem
230
Landhaus
stehen und sitzen unter einem Tulpenbaum drei nackte Gestalten: ein
Greis sitzend, von den vielen Jahren eines langen Lebens wie
überhangen gleich einem Weidenbaum von seinen Zweigen, neben ihm
ein Mann aufrecht, mit irgendeinem Handwerkszeug beschäftigt, ein
wenig abseits davon, über den Zaun blickend, ein Knabe. Es glich
einem Bild von Marées.
Hier war Kaste in der Haltung, im puren, im atmenden Dasein
aufgelöst, war in Ordnung übergegangen, Vermählung von
Körper und Seele. In jedem Falle hatte die Nacktheit der drei
Körper nichts mit Natur, Maß und Freiheit zu tun und war
ganz ungriechisch.
Ich habe einmal einen Paria beschrieben, jenen im Hotel von Kalkutta,
der jeden Morgen von meinem Diener ins Hotelzimmer hereingelassen
wurde, damit er gewisse Dienste verrichte, vor denen ein Mensch von
Kaste zurückscheuen würde. Man muß das in meinem
Aufsatz über die Eitelkeit (Das
Physiognomische Weltbild) nachlesen. Dieser Paria war zwar
bekleidet mit einem hemdartigen Rock, der bis zu den Knieen reichte,
machte aber dennoch den Eindruck des ganz Nackten. Sein Fleisch an den
Armen, Beinen, Backen, im Genick und überall war wuchernd, wild,
aus dem Sumpf gewachsen. Es erinnerte in der Tat an Sumpfpflanzen und
an das Prolixe derselben. Man mußte es ihm, seinem Grinsen ins
Leere ansehen, daß er ohne Ordnung und Maß war oder
daß er seine Ordnung in der bloßen Vermehrung, in sinnloser
Vermehrung finden müßte und in nichts anderem. Ich habe ihn
uneitel genannt, weil es so schien, als müßte sich sein
Blick vor dem Spiegel zerstreuen. In der Tat war das Eitle in ihm
gestockt: im Fleisch, im Wuchernden, Wilden, Prolixen des Fleisches,
und im Sinnlosen des ganzen Wesens. Er war der vollkommene Gegensatz des
231
Überwinders,
völlig undurchleuchtet, opak. Wie Fleisch opak ist.
Wir in Europa verstehen Kaste nicht mehr, und wir verstehen auch die
Idee der Kaste in Indien nicht, wenn wir nicht einzusehen versuchen,
daß unsere Idee des Humanen in Indien fehlt oder daß an
Stelle des Humanen Kaste steht, das Magische derselben. Welches sich
dann im Geschlechtlichen gespalten hat und gespalten bleibt. Daher
kommt in den Verkehr der Geschlechter, in das rein Sexuelle ein
Trauerbeladenes, fatal und dumpf zugleich, und daher fehlt darin auch
unsere Form der Zweideutigkeit und des Witzes, was alles letztlich auf
eben das genannte Humane zurückzuleiten ist. Im Zweideutigen hat
sich das Humane erschöpft oder mit dem Leeren identifiziert. Das
Humane war aber einmal dagewesen, was entscheidend ist.
Bei welchem Reiseschriftsteller habe ich es nur gelesen, daß sich
die keuschesten Mädchen (keusch vom Fleisch her zunächst)
unter den Menschenfressern am Kongo finden? Daß sie, am
Sklavenmarkte ausgeboten, Seelenqualen erdulden, wenn sie von den
Käufern oder Verkäufern auf ihre Jungfräulichkeit hin
untersucht werden? Man wird mich fragen, was Menschenfresserei mit
Kaste zu tun habe oder mit dem magischen Leibe. Sehr viel, denn die
Anthropophagie steht vor der Magie oder geht ihr voran wie das Chaos
vor der Ordnung.
Die Freudenmädchen der beiden magischen Kontinente Asien und
Afrika haben alle, welcher Religion oder Rasse immer sie angehören
mögen, etwas von behängten, bekränzten und bemalten
Idolen. So sitzen sie in den Türeingängen ihrer Häuschen
in Tunis, auf den holzgeschnitzten Balkons in Lahore, auf breiten
Brettern der Buden, wie Ware in Läden feilgeboten, in der weithin
232
sich
ausdehnenden, Gärten umfassenden Freudenstadt von Kalkutta. Wie
bei Idolen weiß man bei ihnen nicht, was Abwehr und was
Verführung sei. Ihre Eitelkeit ist wie das Verzerrte von Herzen,
die leer geworden sind. Wir Humanen machen einen Unterschied zwischen
leer und eitel. Um der Revolte willen, ohne welche das Humane nicht
bestehen, vielmehr zur Geltung kommen will und kann. Die Idole sind
ohne Revolte oder haben die Revolte übersprungen.
Ich befand mich in Samarkand zur Zeit des Ramazan, des Fastenmonats der
Mohammedaner, machte das Fest gleich am ersten Tag und in der ersten
Nacht mit. Tagsüber darf weder gegessen noch getrunken oder
geraucht werden, was die Sarten und Turkmenen, die wie im übrigen
alle Moslems eine ganz eindeutige Beziehung zum Genuß besitzen,
im höchsten Maße reizbar macht, so daß ein Fremder und
Andersgläubigem zu solchen Zeiten Insulten leichter ausgesetzt
bleibt als zu anderen. Unmittelbar nach Sonnenuntergang erdröhnt
ein Kanonenschuß, zum Zeichen dafür, daß das Fasten
bis Sonnenaufgang gebrochen wird. Die Straßen füllen sich
mit Menschen, auf den Plätzen werden Schafe am Spieß
gebraten, Köche und Küchenjungen halten lange Reihen und
Kränze von Schaschlick über ihre Schultern und tragen sie
schreiend durch die Menge, Backwerk wird angeboten, Trauben und von
Zucker triefende Pfirsiche mit sehr dicker, zäher Schale, dem
überaus trockenen und heißen Klima Mittelasiens
entsprechend. Junge Männer, Jünglinge lustwandeln rauchend
oder stehen gaffend vor Marionettenbuden, viele von ihnen halten eine
Wachtel im Hohlen der Hand, die von Zeit zu Zeit aus ihrer Heimlichkeit
den Wachtelschlag von sich gibt. Es gilt für elegant, so eine
Wachtel mit sich herumzutragen im Hohlen der Hand. Wenn
233
es
mir auch nicht gelungen ist, zu erfahren, woher sich diese Gewohnheit
ableite und was sie bedeuten oder bedeutet haben möge, so
möchte ich dennoch auf Fruchtbarkeit, Liebesdrang oder
ähnliches raten. Nachdem es Nacht geworden war, nahm ich mir einen
russischen Fiaker und fuhr durch breite Pappelalleen zwischen
Baumwollpflanzungen nach der Freudenstadt Samarkands, wohin wir trotz
schneller Fahrt beinahe eine Stunde brauchten. Auf den Balkons der
Holzhäuser daselbst, die auf Höfe gingen, wiederum diese
ernsten Idole von Frauen, junge und ältere Tartarinnen, neben
jeder ein Käfig mit der Wachtel. Unten gingen Männer auf und
ab oder blieben stehen, darunter wiederum die Elegants mit der
schlagenden Wachtel im Hohlen der Hand. Es ist nebenbei anzunehmen,
daß noch keiner von ihnen seit undenklichen Zeiten einen einzigen
Gedanken darauf verschwendet habe, wie sich wohl so eine Wachtel in
solcher Lage befinde, in der sie durch Stunden zu verweilen hat. In den
Häusern drinnen wurde getanzt, die Tartaren und Tartarinnen
saßen sehr ernst da an den Wänden entlang; was an Lachen,
Ausgelassenheit und Witz geboten wurde, das ging ausschließlich
von den russischen Beamten oder Kaufleuten aus, die hierzu aufgenommen
zu sein schienen: als Spaßmacher, als Hanswürste.
Eine Szene in Edinburg oben am Berg über der Stadt, vor der
Kaserne eines schottischen Regiments. Auf einer Bank neben dem
Eingangstor sitzen zwei Freudenmädchen, die eine noch mit dem
Schein der Jugend, die andere das bleigraue Gesicht von der
entsetzlichen Krankheit ihres Berufes angefressen, so daß sie von
ferne dem Gespenst einer Toten gleicht, das hier Wache hält. In
dem Augenblick öffnet sich die Seitentür und
234
zwei
Tommies mit roter Jacke und im Kilt treten heraus, das Käppchen
schief auf dem Kopf, mit der Gerte die Luft peitschend. Kaum daß
sie der beiden Frauen auf der Bank ansichtig geworden sind, brechen sie
in Gelächter aus. Es ist so, wie wenn sie sie mit dem
Gelächter anspucken wollten. Genau so sieht es aus.
Ein Ähnliches wäre unter Asiaten weder möglich noch
vorstellbar. Was alles auf eben den magischen Leib zurückgeht, auf
das Undurchdringliche des grinsenden Idols, auf die magische Nähe
des Tieres (zum Unterschied von der naturgegebenen bei uns), auf die
Kaste, auf eine Art der Eitelkeit, welche dem magischen,
wiedergeborenen Menschen einverleibt erscheint und daraufgepappt ist,
der Schminke gleich bei uns. Im höhnischen Gelächter der
beiden herrlich gewachsenen Schotten mit den nackten Knieen unter dem
Kilt lebt ganz tief unter der Schwelle des Unbewußten allerhand,
was gar nichts mit Hohn zu tun hat: Zuallererst die Idee von der
Fleischessünde, wie sie in der Bibel steht, die Idee dann von der
Überlegenheit des Mannes über die Frau, wovon gleichfalls die
Bibel redet, von Jugend, Gesundheit, Schönheit. Aus all dem heraus
wurde dann auf das bleifarbene Totengesicht der einen gespuckt,
vielmehr darüber gelacht oder würde man, wenn man von Natur
aus weniger simpel wäre, als man es ist, einen Witz gemacht haben.
Der Witz oder Humor des Asiaten innerhalb des Sexuellen ist alles eher
als Ausdruck der Zweideutigkeit, er zwinkert und schielt nicht, sondern
ist clownisch, clownhaft. Der Clown als solcher ist nicht nur nicht
zweideutig oder Träger der Ironie, sondern — wie soll ich das nur
sagen? Er ist trotz allem, obgleich vielleicht am Anfang der Welt etwas
gerissen oder geplatzt oder auseinandergegangen war und also nicht
stimmt, eindeutig. Das ist
235
das
Wunderliche an ihm. Er ist eindeutig wie ein Ding, wie ein Spielzeug,
wie der Name, der auf einer Sache picken bleibt und nicht mehr losgeht,
wie etwas, das man anrührt und das jeder kennt, sobald es genannt
wird. Ich wüßte als Beweis für die Tatsache des
clownesken Witzes innerhalb des Erotischen beim Asiaten kein besseres
Beispiel als in Tausendundeiner Nacht die Erzählung, welche in der
neunten Nacht anhebt: Der Lastträger und die drei Damen.
Der englische Clown, der wirkliche, der ganz echte also, ist
geschlechtslos. Besser: er ist so aus dem Männlichen heraus da,
als ob das Männliche allein das Menschliche und es darum
gleichgültig wäre, ob einer aus Fleisch, Holz oder Leder sei.
Er hat sich unter anderen in einer Welt bilden können, darin man
gewisse Dinge nicht gerne beim Namen nennt. Er ist der Witz, der Humor
innerhalb einer Gesellschaft, zu welcher der Cant gehört oder die
ohne Cant leicht unanständig wird: unanständig ohne Witz,
ohne Ironie. Der Clown ist eine sehr unfranzösische Sache, auf
alle Fälle nicht auf französischem Boden gewachsen.
14
Ich will jetzt ein überaus geringfügiges Erlebnis kurz
erzählen, das aber trotz seiner Geringfügigkeit die tiefste
Ausdeutung ermöglicht und mich noch einmal zurückbringt auf
die Relation zwischen dem magischen Leib und dem erotischen
Menschenwesen.
Ich habe meine Reise nach Turkestan von Rußland aus unternommen,
wozu es der Erlaubnis von seiten des Ministeriums des
Äußeren sowohl als auch einer Empfehlung vom Kommandanten
der Leibgarde des Zaren bedurfte. Die erste Station war Bokhara, die Stadt der
236
dunkelbärtigen
Sarten, die zweite Samarkand, nach der es mich schon um des herrlichen
Namens willen seit meiner Jugend gezogen hat. Wenn ich heute dieser
Stadt gedenke, fallen mir gleich die Schulen ein, darin der Unterricht
in der warmen Jahreszeit im Freien gegeben wird. Ich sehe vor mir in
den offenen Loggien im Hofe der hochberühmten islamitischen
Theologenschule, von der seinerzeit das schon genannte Dogma
ausgegangen war, daß die Frau keine Seele habe, ich sehe in ihnen
je einen Lehrer und einen Schüler einander gegenübersitzen.
Zwischen beiden der Koran, in der Hand des Lehrers der Stab. Ich
gedenke der Judenschule am Marktplatz mitten unter feilschenden
Kaufleuten und Bauern vom Land. Die Judenkinder hocken am Boden rings
um einen Lehrer mit einem sehr fleischigen Gesicht, der auf einem
Schemel sitzt. Neben ihm eine Rute und ein Topf mit Wasser. Ich dachte:
zur Kühlung des erhitzten, vollblütigen Lehrers mit den
fleischigen Backen und dem roten Hals. Falsch, denn schon sehe ich, wie
er einen der Jungen vor sich erwischt, ihn übers Knie biegt und
den entblößten kleinen Hintern, bevor die Rute appliziert
wird, mit Wasser aus dem Topf neben sich ein wenig befeuchtet.
Unter den vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt nannte mir mein
Führer das Grabmal eines heiligen Mannes, das vor der Stadt lag.
Ich nahm also eine russische Droschke und machte mich dahin auf den
Weg, der Führer, der Russisch sprach, oben auf dem Bock. Der Weg,
erinnere ich mich, war so voller Löcher und so staubig, daß
ich schon umkehren und den heiligen Mann in Ruhe lassen wollte. Wir
mußten durch eine ganze Schar von Leprakranken hindurch, die vom
Felde heimkamen. Männer, Frauen, Kinder. Jede größere
Stadt hatte in Turkestan in einiger Entfernung vom Weichbild
237
eine
Siedlung von Leprakranken, mit eigener Moschee, eigenem Ulema, eigenem
Doktor, die alle gleichfalls von der Lepra befallen sind. Die
Leprakranken heiraten untereinander, kriegen Kinder, die dann wiederum
untereinander heiraten und Kinder kriegen und so fort. Die Besitzenden
und Landeigentümer unter ihnen sind Leprakranke, die Arbeiter sind
es, die Rechtskundigen, kurz alle. Die Frauen tragen keine Schleier.
Wenn man einer Menschenschar mit Schaufel, Hacke oder Korb begegnet in
diesen Landen, so braucht man nur darauf zu achten, ob die Frauen
verschleiert gehen oder nicht. Ich habe versucht, so gut es ging, durch
die Staubwolken hindurch, die sich immer von neuem ganz dicht erhoben
unter den Hufen und Rädern meines Gespannes und unter den eilenden
Schritten der heimkehrenden Leprosen, irgendwelche Anzeichen der
Krankheit zu erkennen. Mehr war aber nicht zu sehen als ein unfrischer
Zug in den Gesichtern der meisten, vielleicht auch ein Verzagtes, wie
es Menschen nach einer Berauschung haben. Die von der Krankheit schon
Betroffenen dürfen wohl die Häuser der Siedlung nicht mehr
verlassen.
Das Grabmal des Heiligen, im Schatten von mächtigen
Pappelbäumen zwischen Fruchtgärten gelegen, gleicht allen
anderen, wie sie über die weiten islamitischen Lande Asiens und
Afrikas verstreut sind. Unter der Kuppel steht der
weißgetünchte Sarg. Neu war mir und den Blick gleich auf
sich ziehend: statt der Straußeneier, die in der Sahara über
den Särgen der Marabus hängen, das Gehörn einem
Steinbockart, wie sie in den kahlen Gebirgen an der Grenze von
Turkestan und Persien vorkommt. Überall in den Erdteilen des
magischen Leibes dasselbe Phänomen, daß zum
wundertätigen Grabe des Enthaltsamen die Symbole der Fruchtbarkeit
und zeugenden
238
Kraft,
Ei und Gehörn, dazugetan werden: um des Gleichgewichtes willen, um
des Gestirnes willen, um der Pilgerfahrt willen.
Als wir einigermaßen verstaubt vor dem Grabmal hielten, ging mein
Führer den Schlüssel holen. Es dauerte eine Weile, bis er den
Türhüter gefunden hatte. Und jetzt geschah, während er
diesen herbeibrachte, das folgende, was, wie gesagt, fast nichts oder
sehr wenig zu sein schien und doch voll von Sinn stak. Der
Türhüter sagte zu meinem jungen, sehr ärmlich
gekleideten, verhungert aussehenden Sarten, ohne sich dabei aufzuregen,
fast gleichgültig, nebenher, wie man sich etwa nach einem sehr
entfernten Verwandten schnell und beiläufig erkundigt: Ich habe
die ganze Zeit über gemeint, du seist gestorben. Nichts anderes
als das und dies, noch einmal, so nebenher, während er aus
mehreren Schlüsseln am Schlüsselbund den richtigen
wählte. Auf das hin brach nun aus dem Sarten, indem Körper,
Hals, Kehle sich spannten, ein Fluchen aus, wie ich es vorher und
seitdem nicht mehr gehört habe oder meine Vorstellung es nicht
für möglich gehalten hätte. Es war in jedem Sinne anders
als alles Fluchen bisher, obwohl ich einige Erfahrung darin zu haben
glaubte und unsere Bauern in Mähren oder russische oder ungarische
hierin auch etwas zu leisten imstande sind. Es war jedenfalls das
Fluchen keines Christen. War es das eines Menschen? Nein, es war so,
wie wenn ein Rohr platzt und das ganze Wasser ausströmt. Man fragt
unwillkürlich: Gibt es so viel Wasser auf der Welt? Oder woher
kommt so viel Wasser? Oder wird das Wasser je ein Ende nehmen?
Natürlich hört es einmal auf, und zwar ganz plötzlich,
so daß man noch einmal staunen muß: über das
Plötzliche des Aufhörens. So war der ganze, recht armselig,
mit kaum mehr als mit Lumpen
239
bedeckte,
etwas skrofulöse Mann zu einem Rohr, zu einer Leitung geworden,
daraus sich Fluch über Fluch stürzend ergoß, vielmehr
ein ganzer Strom von Flüchen ausfloß.
Worüber aber oder warum fluchte er so? Über den
Türhüter natürlich, zu ihm hin, der aber ganz still
blieb und nicht das allergeringste Zeichen von Erregung, kaum
Betroffenheit zeigte. Er konnte und wollte das, was auf ihn
einströmte, nicht fassen oder in sich aufnehmen, sondern stand da
wie ein Mann im Wasser, das plötzlich angeflossen kommt. Der Mann
bleibt stehen und streift die Hosen über die Kniee oder zieht die
Stiefel aus. Das erstaunlichste aber war, daß der fluchende Sarte
selber nicht erregt schien, wie unsereiner sich aufregt, wenn er laut
wird, Blutandrang bekommt und ähnliches. Ist ein Rohr erregt, das
da platzt? Nein. Es war so, wie wenn das ganz entsetzliche, scheinbar
endlose Fluchen von den Vorfahren her in ihm gelegen hätte und
einmal aus ihm heraus müßte. Und als es dann wirklich heraus
und er ganz, ganz still geworden war, so still wie eine Landschaft nach
einem Unwetter, sagte er mir, während wir durchs Tor zum Sarg des
Heiligen schritten — der Türhüter hatte sich schon verzogen
und unterhielt sich mit dem Kutscher —, sagte er durchaus sachlich: Er
hat mich statt au grüßen gefragt, ob ich noch am Leben sei;
er habe gedacht, ich sei schon gestorben. Das ist das Ärgste, was
ein Mensch dem anderen antun kann: ihm eine solche Frage stellen.
Diese, ich wiederhole, überaus geringfügige, in gewissem Sinn
lächerliche Szene zwischen zwei so ganz bedeutungslosen Menschen,
wie dieser ärmliche Führer und der fühllose, schmutzige
Türhüter mit seiner wie verrosteten Kehle es waren, habe ich
nie aus dem Sinn ver-
240
loren,
ein ganzes Menschenalter oder beinahe soviel nicht. Heute aber erst
kann ich sie mir deuten, damals konnte ich es nicht. Darum wohl
mußte sie in mir liegen bleiben und sich bewahren. Vielleicht
kann und muß ich aus diesem Grunde auf der Stelle und ohne
Übergang die großartigste Deutung damit vornehmen oder ihr
zukommen lassen.
Etwas hat hier gefehlt oder war nicht vorhanden gewesen. Woher auch das
Übermaß des Fluchens zu erklären war, die
Überschwemmung damit und dann das plötzliche Aufhören,
die Stille und die Gleichgültigkeit, die darauf folgte. Was hat
also gefehlt, was war nicht dagewesen? Ich sage es ohne Umstände:
der Mittler hat gefehlt, und zwar dieser in jedem Sinne. Seitdem ich
jetzt weiß, daß er gefehlt hat, seitdem ich das fühle,
weiß ich erst, was Mittler oder Mittlertum ist oder bedeutet,
oder weiß ich es viel genauer, als ich es je früher
gewußt habe. Dieser fluchende, sich im Fluchen ganz und gar
ausschüttende Moslem, dieser bis in die Wurzeln
Abergläubische und abergläubisch an seinem armen Leben
Hängende sah nur die eine Seite der Dinge. Gleich allen
fanatischen Menschen, Fatalisten und Abergläubischen (in unserer
Christensprache). Und darauf legte sich dann jenes wahre Unwetter von
Flüchen: auf diese eine Seite. Jedes Unwetter kommt so, wie es
kommt, weil oder indem sich ihm nur die eine Seite der Dinge darbietet
und nicht auch die andere. Nun frage ich mich, ob nicht der, welcher
die beiden Seiten der Dinge sieht oder sehen will, dazu den Mittler
brauche. Durch ihn, den Mittler, wird nämlich das Sehen der beiden
Seiten eine Tat und hört auf, eine Schaukelei, ein
Dazwischen-sich-zurecht-Finden zu sein. Durch den Mittler wird es
plastisch, wird das Sehen heroisch. Darum und daher der Mittler und das
Mittlertum.
241
Die
eine Sicht, die Einseitigkeit derselben seitens eines fanatischen
Menschen oder seitens des Fatalisten hat nur Sinn oder ist plastisch,
wenn der Weg geradeaus führt zu jenem strengen und richtenden
Gott, der da sagt: Ich bin, der ich bin. Wenn ihr dieses letzte und
ganz bestimmte Ziel fehlt, wird sie, die Einseitigkeit, roh und gemein
wie das Fluchen meines armseligen Sarten. Oder wie der bloße
phallische Akt, wie der phallische Erguß, diese eine fanatische
Tat des Körpers. Die gleichfalls noch des Mittlers entbehrt und
darum gar nicht anders als in Leere oder Übertreibung enden kann.
Denn erst indem sich der phallische Akt zum erotischen erhebt, tritt
der Mittler in Aktion. Weshalb auch Plato den Eros, das Kind der Armut
und des Reichtums, Mittler nennt.
Wenn die magische Welt zu Ende gekommen und der magische Leib sich
erschöpft hat, dann ist die Zeit der Mittler da. Es gibt keinen
Mittler und hat nie einen gegeben, dem nicht eine lange Periode des
Magischen vorangegangen wäre. Also sind die Mittler nie am Anfang.
Dieser bestimmt stets die magische Welt, welche gleichsam aus dem
Anfang ist. Der letzte Sinn der Mittler ist, daß das Geheimnis
sich nicht erschöpfe. Darum lieben die Menschen sie und halten sie
für Söhne Gottes, die eingeborenen. Wenn das Leben aus dem
Anfang wäre, so müßte es sich schon längst
erschöpft haben gleich dem phallischen Akt oder gleich den
Verwünschungen des abergläubischen Sarten in Samarkand.
Und dann noch eines, womit ich meine Deutung auch beendet haben will:
Wo und wenn die Mittler fehlen, dort besteht die Gefahr, daß der
Mensch oder die Welt des Menschen gemein werde. Nebenbei ist das
Gemeine stets der Ausgang einer Erschöpfung, wohinter immer es
sich zu verstecken versuche. Darin liegt die große Ge-
242
fahr
für den Menschen des magischen Leibes, für den Menschen
Asiens, der aus den magischen Bezirken seiner Welt, welche mit der
Vergangenheit, Religion, Kaste und Sitte gegeben ist, heraustritt,
daß er, indem er Europa nachahmt, die europäische Geschichte
nach-erleben will, seines Reizes im tiefsten Wortsinn verlustig gehen
und gemein werden muß.
Noch eine Frage an den Schluß angehängt: Ob nicht die Opfer
der Psychoanalyse — nennen wir sie so — etwas sind wie heimliche,
versteckte, unglückliche Fanatiker oder Abergläubische des
Lebensbegriffes, des Lustbegriffes, des Triebbegriffes oder
ähnlicher Begriffe? Aus einer Welt kommend, in einer Welt lebend
ohne Mittler. Ohne Einbildungskraft. Mit einer ewigen Angst vor
Mediokrität, im letzten selber durchaus mittelmäßig.
Die alte magische Welt kannte den Begriff der Mediokrität nicht.
Dadurch war die magische Welt vor allem ausgezeichnet. Als sie zu Ende
kam, gab es nur den Mittler in eben dem Sinn, den ich angegeben, gab es
ihn gegen die Mediokrität oder Gemeinheit.
15
Was ich mich beim Bekanntwerden mit fremden Volksstämmen, beim
Anblick neuer Menschenarten, Menschenleiber stets fragte, ist das: Wie
bringen sie die Zeit hin? Wie füllen sie die Zeit aus, die ihnen
gegeben ist? Entstehen da nicht Lücken, Risse und leere Stellen?
Wie sich solche bilden müssen bei einem Menschen, der nur mit
Zwecken und Absichten ausgefüllt erscheint, beim Unfreien und
Isolierten. Beim Taktlosen im weitesten Wortsinn. Wo Zweckvorstellungen
und Absichten vorherrschen, bleibt der Mensch isoliert und wird
unwillkürlich, wie gesagt, taktlos. Zeiten oder Zeitabschnitte
interferieren dann.
243
Indem
nun der magische Mensch in Gruppen lebt, können sich solche
Interferenzen oder Risse, Lücken oder leere Stellen nicht bilden.
Weshalb die Bewegung der Gruppe als solcher und infolgedessen auch die
des Gruppenmenschen unter allen Bedingungen rhythmisch verläuft.
Wer von allen denen, die nach dem Osten ziehend in Port Said Halt
machten, erinnert sich nicht der dunklen Rhythmen in Gesang und
Gebärde, wenn Neger, Halbneger, Menschen des Hafens, frische Kohle
in die harrenden Dampfer schaufeln! In Bombay sehe ich vom Balkon
meines nach Öl riechenden Hotels, wie ein Klavier über den
Platz getragen wird, irgendwohin. Welcher Aufwand an Menschenbeinen,
Menschenschultern! An Menschenstimmen, aus denen dann allmählich
ein Gesang sich bildet und zu mir aufsteigt. Die Einigung hatte sich
langsam und unter Streit vollzogen, aber endlich ist sie da, und der
wahrscheinlich sehr verstimmte Klavierkasten schwebt glorreich in einer
Wolke von Stimmen durch die Luft. Doughty erzählt in seinem
wundervollen Buch Arabia deserta,
wie das Zerstampfen der wenigen Kaffeebohnen im kleinen Mörser
morgens, bevor sich das wandernde Gefolge eines Scheiks um das Feuer
setzt, um aus winzigen Tassen die drei bis vier Schlucke des kostbaren
Getränkes zu nippen, einen überaus reichen, rhythmischen Akt
voll überströmendem Menschlichkeit vorstellt seitens des
Scheiks selbst, der den kleinen Stampfer im Mörser hüpfen
läßt. Bei Tempelausgrabungen im südlichen Ägypten,
denen ich beiwohnen konnte, gab es Szenen wie im Rheingold zwischen
Alberich und den Zwergen, die den Nibelungenschatz herbeischleppen. So
trieb dort der Aufseher die grabenden und siebenden Arbeiter, meist
halbwüchsige, zudem zwergige Menschenkinder, mit einer kleinen
Peitsche
244
an.
Letztere bildeten in jeder Lage eine Gruppe, waren in jedem Augenblick
ein einziger Körper. Und was da zwischen dem
peitschenschwingenden, scheinbar sinnlos tobenden Aufseher und der sich
drängenden, schiebenden und überstürzenden Gruppe
kleiner Menschlein lag, das war echte dramatische Spannung, ich
möchte sagen: ein Bogenelement der dramatischen Urspannung, die
sich ebensowenig wie die Gruppe oder der tobende Aufseher selbst
zerlegen ließe.
Das rhythmische Leben bringt beides mühelos zusammen: Not und
Verschwendung. Und soweit sich das Leben aus beiden zusammensetzt, ist
es rhythmisch. Das sogenannte Taylorsystem will Not und Verschwendung
der bloßen Ökonomie oder rein ökonomischen Zwecken
opfern, und so geht die schöpferische Urspannung verloren und
kommt es zu Interferenzen, Leerläufen, schließlich auch zu
Un- und Irrsinn.
Man liest gelegentlich in Reisebüchern, Wilde seien faul. Ich
glaube, auch der sonst so gut beobachtende C. Jung in Zürich
urteilt so. Sind sie es wirklich? Oder sind sie es nur von unserem
Standpunkte aus, vom Standpunkt des Einzelnen, vom Standpunkt des
Zählenden und den Gang seiner Taschenuhr nach dem Signal der
Sternwarte Regulierenden? Ist dieses Faulsein nicht vielmehr ein
richtiges Aus-Spannen nach den mancherlei rhythmischen Erregungen im
Leben der Wilden wie der Jagd und anderen?
Ich möchte darüber noch etwas sagen: über das
höchst bedeutsame und ganz und gar wundervolle Zusammensein des
rhythmischen und des magischen Lebens. Ein indianischer Stamm in einer
Gegend, wo Bisons vorkommen, führt, bevor es zur Jagd kommt,
Tänze auf, und zwar oft Tage lang, auf alle Fälle so lange,
bis sich
245
ein
Bison zeigt. Der dann erlegt wird. Sie beschwören das Tier mit
ihren Tänzen, und es erscheint ihnen ganz natürlich,
daß es oder daß mehrere dann auch kommen. Aus dem
Gesichtspunkt des Einzelnen oder Isolierten erscheint das alles
unsinnig, und wie sollte es auch nicht? Der Einzelne und Isolierte
urteilt: einmal muß der Bison kommen, und sollte er einmal nicht
kommen, so ist das Zufall.
Dieser Einzelne nun versteht die Gruppe nicht, von welcher allein aus
ein notwendiger Zusammenhang zwischen dem Tanz der Indianer und dem
Erscheinen des Bisons besteht. Der Einzelne als solcher darf darum in
der Gruppe nicht vorkommen oder muß daraus verschwinden,
eingesperrt oder geknebelt oder meinetwegen getötet werden.
Daß muß er wohl, denn er ist dort nur sinnlos.
Das Leibgericht der Beduinen um Tuggurt herum, wohl in der ganzen
Sahara, ist der Kuskus, Stücke von Schöpsenfleisch, in einer
hellgelben fetten Brühe schwimmend. So sitzen sie, die Männer
der Wüste, an Tagen, da es ihnen wohlgeht und ein Schaf
geschlachtet wurde, um eine große Schüssel herum, jeder mit
dem Löffel die Speise vom Rande her zum Munde führend. Eines
aber ist dabei strenge verpönt: mit dem Löffel in die Mitte
der Schüssel fahren, sollte dort zufällig einmal ein gutes
Stück Fleisch auftauchen, und nicht nur dann. Denn aus der Mitte
löffelt Allah. Oder in der Mitte sitzt Allah und ißt mit,
unsichtbar, den Geisterlöffel schwingend. Ich zog damals in der
Wüste mit einem seinerzeit dort sehr berühmten Poeten umher,
der auch André Gide auf dessen Touren in Südalgerien von
Oase zu Oase begleitet hatte. Von ihm hatte Robert Hichens, wie der
Araber nicht ohne Stolz erzählte, den Titel seines damals viel
gelesenen
246
Buches:
The garden of Allah. Als der Engländer nämlich von Biskra aus
in Begleitung des Poeten, der zugleich als Diener und Führer
fungierte, zum ersten Mal in die Wüste fuhr, soll er erstaunt
gewesen sein über deren große Schönheit. Worauf der
Diener, dessen Namen ich vergessen, ausrief: Sir, it is the garden of
Allah. Er war es auch, der mir von der Regel beim Kuskusessen
erzählte. Sie ist in der Tat sublim und darf gar nicht anders
bezeichnet werden. Auch hier könnte der Einzelne, wenn wir ihn zur
Diskussion zulassen und nicht lieber gleich knebeln im Namen Allahs,
der in der Mitte wohnt und die Mitte ist, könnte der stets
Interferierende, Intervenierende und wesentlich Taktlose leicht alle
seine möglichen Einwände anbringen: unvermeidlich
fließe die Mitte gegen den Rand der Schüssel ab, und wenn
die Leute am Rande mit dem Kuskus fertig seien, so wäre Allah in
der Mitte dann auch damit fertig. Worüber nicht viel Worte zu
verlieren wären. Die Regel, die Vorschrift oder Sitte geht allein
den Gruppenmenschen an und geht von ihm aus. Und wenn es innerhalb
dieser Gruppe überhaupt den Einzelnen gibt, so ist es Allah, Allah
in der Mitte, in der magischen Mitte. Alle Mitte ist magisch. Und wenn
in dieser Mitte der König ist als der Einzelne, Isolierte eines
Stammes, Volkes oder Reiches, so ist der König von Gottes Gnaden.
Denn Gnade ist nichts anderes als Magie, aus dem Reich der Gruppe in
das Reich des Einzelnen und der Freiheit getragen.
Von hier aus ließe sich eine ganze Staatslehre konzipieren. Und
zwar genau von Allah, der aus der Mitte heraus den Kuskus löffelt,
über Platos Staat zum Pflichtbegriff Immanuel Kants und noch
weiter bis dorthin, wo man ohne Gnade auszukommen sucht. Bei Kant und
durch Kant ist jedenfalls der Mittebegriff, ist die Magie
247
aufgehoben
oder an deren Stelle der Pflichtbegriff getreten. Darin liegt auch
dessen große Bedeutung.
16
Von Tuggurt in Südalgerien aus, wohin man damals nur mit der
sogenannten Wüstenpost gelangte, die morgens um drei Uhr aufbrach
und von Biskra zwei Tage brauchte, während heute die Eisenbahn den
Reisenden in wenig Stunden dorthin befördert, fuhr ich nach dem
südlich gelegenen Tlemcen, um eine Siedlung mitten in der
Sandwüste zu besuchen, die zugleich Burg, Festung, Grabdenkmal
ist, rings umgeben von krenelierten Mauern aus dem Sand und Lehm der
Wüste mit einem gewaltigen eisenbeschlagenen Tor aus Palmenholz.
Als ich in meinem Sandcar mit den sehr breiten, eisernen Rädern
vor dem Tor hielt, öffnete sich dieses wie im Märchen,
zahllose Neger schoben die beiden Torflügel auf, lachend mit ihren
fleischroten Lippen, während das übrige Gesinde sich auf den
Zinnen der Mauern verteilte, mit den Beinen baumelnd und grinsend und
schreiend vor allgemeiner Freude und Staunen. Es war in der Tat ein
großer Akt, ein großer Beginn. Der Besitzer des Schlosses
ist der späte Nachkomme eines berühmten Marabu, der zugleich
Heiliger und Krieger gewesen war, als der Islam noch erobernd auftrat
und heilige Männer solcher Art aus ihm hervorgingen. Sein Grab ist
eine Pilgerstätte erster Ordnung in der Wüste, und die
Nachkommen haben den Rang von Fürsten. Der gegenwärtige
Besitzer war auf der Fahrt nach Mekka begriffen, sagte man mir, und
zwar nicht zum ersten Male in seinem Leben, und so wurde ich von seinen
beiden Söhnen empfangen: dem lichten, blonden Sohn einer
Berberfrau, und dem dunklen einer Negerin. Man konnte an Ariost
248
denken,
an Shakespeare. Ich wurde in ein Gemach geleitet, das wohl als
Empfangsraum zu gelten hatte, einen gar gewöhnlichen Tisch
faßte aus Dielenholz und ein paar ebensolche Stühle, wurde
mit Datteln aus einer benachbarten Oase bewirtet, die ich mit Freuden
aß, und mit Kuskus, den ich nur mit größtem
Widerwillen schlucken konnte. Es wurden mir dann die üblichen
Fragen gestellt, wobei mein arabischer Diener den Dolmetscher machte:
zuerst nach meinen Eltern, ob sie noch lebten. Als ich nein sagte, war
man traurig, so zwar, daß sich die Trauer vom lichten Prinzen,
der die Frage hatte stellen lassen, in sinkender Stärke seinem
Gefolge, Jünglingen gleichen Alters, die plötzlich alle
finster dreinblickten, mitteilte. Da ich aber gleich darauf die
große Zahl meiner Geschwister nennen konnte, verzog sich die
Finsternis von den Gesichtern, man wurde wiederum heiter, gleichfalls
so, daß die Heiterkeit hurtig über alle Gesichter vom einen
zum anderen lief.
Der magische Mensch fragt nach den Eltern, nach den Geschwistern, nach
deren Zahl und was davon noch lebt und nicht lebt, er fragt nie nach
dem Ich. Das tut er ebensowenig, wie er beim Kuskusessen mit dem
Löffel in die Mitte fährt. Das muß noch schnell zur
Bestimmung des Ich bei magischen Menschen hinzugesetzt werden, weil
damit alles, was darüber schon gesagt wurde, noch einmal hell
beleuchtet wird. Denken wir dabei schnell noch einmal zurück an
den Kapitän des Xerxes und an den Sohn jenes Großen des
persischen Königs, dessen Leib der Länge nach genau in zwei
Teile gespalten wurde, damit das ganze Heer mitten hindurch ziehe gegen
de Griechen.
Was mir aber besonders an den beiden Prinzen auffiel und mich
merkwürdig ergriff, war, wie sie stets mit Ge-
249
folge,
aber niemals zusammen auftraten. Das ist nicht ein einziges Mal
vorgekommen, obwohl sie doch in einem fort unterwegs zu mir und gleich
wieder weg waren. Es sollte offenbar vermieden werden, daß sie
einander mit ihrem Gefolge in der Tür beim Hereinkommen oder
Herausgehen begegneten. Und damit ging wunderbar zusammen, daß
beider Auftreten immer ganz plötzlich war und ebenso
plötzlich und durchaus unvermittelt ihr Abtreten. Offenbar sollte
ich nicht einen Augenblick lang aus dem Staunen herauskommen, darauf
hatte man es abgesehen. Der lichte war der lebhaftere von beiden,
lebhafter in der Sprache und in den Gebärden, so auch sein
Gefolge, das ihn ununterbrochen widerspiegelte. Der Gedanke ist nicht
zu denken, was geschehen sein würde, wenn der lichte oder auch der
braune Prinz einmal allein, vielmehr sich selbst überlassen
geblieben wären. Es geschieht eben nicht, und es darf darum so
gesagt werden, wie ich es sage, und nicht anders, weil wir uns hier
doch noch in einer morgendlichen Welt befinden: gegründet und
angelegt mitten um ein Grab, das marmorne eines heiligen Mannes,
darüber große Straußeneier hingen. Einen Augenblick
lang freilich gab es so etwas wie eine Unterbrechung, wie einen
Riß im höchst Erstaunlichen und Glorreichen des Ganzen. Mit
allen Gefahren einer solchen Unterbrechung und eines solchen Risses.
Ich denke noch heute mit Schrecken daran. Folgendes geschah: Der blonde
Prinz — ich sagte schon, daß er der lebhaftere war, lebhafter
auch in den Blicken, im Erfassen der Dinge mit dem Auge — erspähte
plötzlich und sehr genau meine Tabatiere, eine russische, wie man
sie damals hatte: aus lichtbraunem Birkenholz, mit langer blauer
Zündschnur, durch die gar zierlich rötliche Fäden
gezogen waren, den Glanz des Blauen erhöhend, und
250
mit
einem entschieden falschen Saphir darauf. Kaum aber daß er sie
erblickt, ward aller Lärm und alles Gerede kurzweg unterbrochen.
Stille hatte auch vom Gefolge Besitz ergriffen, meine unscheinbare Dose
wurde im Nu so wichtig, daß ich sie dem Prinzen zuerst zur
Besichtigung und gleich darauf als Geschenk anbot und wohl auch
anbieten mußte. Worauf unmittelbar nicht nur der Prinz, sondern
auch das Gefolge in Freudenrufe ausbrach und schon aufbrechen und zur
Tür hinaus wollte, als eben das Entsetzliche geschah, daß
die Dose verschwunden schien. Sie war von Hand zu Hand durchs ganze
Gefolge hindurch gewandert und sollte zum prinzlichen Besitzer
zurück, und da war sie plötzlich weg, nicht mehr da. Wo? Der
Prinz sah mich an. Ist das so merkwürdig? Nein. Aber ach! welches
Fragen, welcher Zweifel in diesem seinen Blick, welche Verzagtheit und
wieviel Unfrohes nach so viel Freude, Trubel, Erregung und Hingabe an
die einzige Gegenwart! Sollte ich am Ende ein Betrüger sein,
weiß Gott von woher, ein Mann elender Tricks und Vorspiegelungen,
kurz ein Windbeutel und Ungläubiger zugleich? Wo war nun alle
Freude hin am Plötzlichen, an überraschenden Eintritten und
Aufbrüchen? Sie war weg, und an deren Stelle war jetzt nichts oder
das Loch des Mißtrauens, darin alles versank. Ich dankte Gott aus
ganzem Herzen, als die Dose wieder auftauchte, und zwar ebenso
plötzlich, wie sie verschwunden gewesen war. Woraufhin es dann den
großen Abschied geben konnte, der doch von Anfang im Sinn des
Ganzen gelegen hatte. Der lichte Prinz empfahl sich, indem er dabei die
Dose fest in der Hand hielt, sagte viele Dinge, die ich mir alle gar
nicht erst übersetzen lassen konnte, weil es so viele waren, und
kam dann noch einmal, da ich schon am Tor angelangt und in
251
Gedanken
mehr mit der Rückfahrt beschäftigt war als mit etwas anderem.
Warum kam er? Natürlich wiederum aus seinem sicheren Gefühl
heraus für Überraschung, Freude, Ruhm, Prinzentum und
Plötzlichkeit, daran auch sein Gefolge teilhatte, vielleicht auch
darum, well der schwarze Stiefbruder, der Sohn der Negerin, nicht
gekommen war. Warum aber war dieser nicht gekommen? Möglich,
daß er sich darum verletzt fühlte, weil es keine zweite
solche Dose gab für ihn. Ebenso möglich aber, sogar
wahrscheinlicher, daß er mich schon vergessen hatte,
plötzlich.
17
Im Rhythmus, im rhythmischen Leben, im Tanz treffen beide zusammen: der
magische und der natürliche Mensch.
Der magische Mensch ist Mitte, hat Mitte und lebt in einer Welt der
Mitte. Und so auch der magische Leib. Wenn es nun heißt,
daß seine Welt oder die Welt seines Gottes: Ich bin, der ich bin aus dem Anfang
oder aus der ersten Ursache sei, so ist dieser Anfang oder so ist diese
erste Ursache auch nichts anderes als Mitte.
Ich gebe das Beispiel einer solchen magischen Mittewelt an: Bevor ein
primitiver Stamm in Mittelafrika, reines Gruppenmenschentum also, Jagd
auf einen Löwen oder Leoparden macht, wird die Jagd geübt,
geprobt, und zwar ganz bestimmt nicht zum Zeichen dafür, daß
das Leben ein Schauspiel sei und so weiter. O nein, sondern einzig und
allein um der Mitte, um des Anfangs, um des Ruhmes und Rausches willen,
der aus allem Anfang hervorstürzt, oder mit anderen Worten, weil
Spiel und Wirklichkeit, Nachahmung und Beispiel eines sind um der
Mitte, um des magischen Leibes willen. Wer das erfaßt, hat vieles
und sehr Wichtiges begriffen.
252
Und
aus dieser Mittewelt heraus führt der Rhythmus, führt der
Tanz. Und zwar als Brücke oder Bogen hin zum Leben der Natur, zum
Leben des natürlichen Menschen. Hier ist dann im Anfang schon das
Ende und im Ende der Anfang gelegen und vorhergesehen oder wie immer
man das nennen mag. Ich habe damit schon seit je das Wesen des
Rhythmischen bestimmt und kann mich dabei nicht mehr aufhalten.
Denn ich will weiter und zurück: nach Europa, zu uns, zu mir, zum
Einzelnen, zum Menschen, der nur noch mehr im übertragenen Sinn
der Magie fähig ist, zum Seher und Menschen der Bilder. Dahin will
ich zurück, davon will ich reden, und zwar, wie sich jetzt
vielleicht ziemt, im Gleichnis. Im Gleichnis vom marokkanischen Esel.
Ich habe die Esel zu allen Zeiten meines Lebens mehr geliebt, als ich
sagen kann, von Anfang, von den beiden Eseln an, Hengst und Stute,
heißt das, mit denen wir als Kinder herumfuhren, sooft jene frei
waren und es keine Säcke mit Hühnerfutter oder Ziegeln zur
Ausbesserung kleiner Hausschäden zu ziehen gab, bis zu jenem
höchst freien und solitären auf der Fahrt von Tuggurt
zurück, als uns der Samum, der Wüstenwind, überfiel. Von
diesem Esel will ich einiges sagen schnell noch, bevor ich zum
eigentlichen, zum marokkanischen komme, schon darum, weil er der letzte
bedeutende Esel meines Lebens war. Esel scheinen nämlich
auszusterben... Niemand sieht einen Esel mehr, liebt ihn, weiß
mehr etwas von ihm zu sagen.
Es war auf einer jener Wüstenstationen, darin die Pferde oder
Maulesel — stets vier, beziehungsweise sechs — gewechselt wurden,
ausgezeichneter Kaffee gereicht und um de Mittagsstunde ein zähes
Perlhuhn oder ein mageres Kaninchen serviert wurde. Der feine
Wüstensand,
253
den
der Samum aufjagte, kam durch alle Ritzen hindurch in die Tassen,
Schüsseln und Teller, schwamm auf der Suppe oben und verdarb den
Kaffee. Man schluckte ihn mit dem Rauch der Zigarette und hatte ihn,
sooft man den Mund auftat und etwas sagen wollte, im Hals. Wir
mußten die Fahrt unterbrechen, bis der Sturm sich besänftigt
hatte, de Pferde wurden in den Stall geführt, der Kutscher und
Postillon, ein Franzose, drückte sein Gesicht fest in die Kissen
des Bettes, das im Speisezimmer stand. Mitreisende wanden ihre
Köpfe in Tücher ein und versuchten, so gut es ging, so zu
atmen. Ich sehe zum Fenster der Wirtsstube hinaus. Da steht im Freien
der Wüste ein Esel, eben der, den ich meine, noch nicht der
marokkanische, aber irgendwie doch jener letzte meines Lebens, steht da
mit dem Gesicht gegen den Sturm, den Kopf ein wenig gesenkt, wie Jogins
es bei gewissen Übungen tun, die Ohren, soweit es anging,
abstehend, damit auch der Rückwand derselben ein Gefühl vom
Ganzen zuteil werde, die Lider über die großen glasigen
Eselaugen gezogen. Und so, mit gespreizten Vorderbeinen fest dastehend,
ließ er sich vom Sand berieseln. Berieseln auf allen ausgedehnten
Flächen und in alle Winkel und Ritzen hinein seines mit guter,
fester, duldender Eselshaut überzogenen Körpers. Was ihn
berieselte, war ein warmer, sehr feiner, der genaueste Sand, Sand von
weit und überall her, Sand der größten Wüste der
Erde, und so blieb der Esel stumm, stumm wie ein Ding, wie etwas, das
sich fest zusammennimmt, damit nichts verloren gehe von der Empfindung
des ganzen Daseins. Ich hatte schon viele Esel sich im
gewöhnlichen Staub der Straße wälzen gesehen und habe
es immer verstanden, warum es bei dieser Prozedur am Ende zu einem
Schrei kommt. Der gehört dazu und beschließt das
254
Ganze,
wie ein lebhafter Punkt einen Satz beschließt. Hier aber war der
Schrei nicht angänglich und würde alles gestört haben,
das war zu fühlen und nach allem auch keinesfalls zu erwarten,
oder ich wenigstens habe ihn nicht einen Augenblick lang erwartet.
Was lag nun nicht alles in dieser Stellung und vollkommenen Stille des
Esels? Ich will trachten, so genau wie möglich zu sein: Umkehr lag
darin, doch nur so, wie ein Esel umkehren kann, der sein ganzes Innere
auf die Spannung, die trommelhafte, seiner Haut verteilt hat. Kann jene
mehr sein als Umdrehung, und zwar de um 180 Winkelgrade? Nein, sie kann
und soll auch nicht mehr sein. Umkehr lag also darin und damit in
engstem Zusammenhang und als unmittelbares Ergebnis die Tatsache,
daß Kitzel und Weisheit jetzt eines geworden waren. Was auch nur
möglich wurde, da alle möglichen Spannungen zwischen Innen
und Außen oder zwischen einem hypothetischen inneren und dem
äußeren Esel gelöst sind und das ganze Wesen desselben
aufgetrommelt erscheint und sich in eben der vollkommenen Spannung
einer gesunden Eselshaut manifestiert. Es gibt auf ihr keinen Ton oder
keinen anderen als den gelegentlicher Prügel, dafür aber jene
Genauigkeit, mit der sich Weisheit und Kitzel ineinander einfügen
und mit der sie ineinander aufgehen.
Doch über diesen algerischen der Wüste, auch über de
kleinen ägyptischen, stelle ich den Esel des Gleichnisses, das ich
oben versprochen habe, stelle ich den marokkanischen, dem ich damals
begegnet bin, als ich in Tanger zum allerersten Mal afrikanischen Boden
betrat, zum ersten Mal die Erde des magischen Menschen und Leibes unter
meinen Füßen spürte. Ich sage: der marokkanische in der
Einzahl, es waren, was sich von selbst ver-
255
steht,
meist mehrere, selten zwei, zuweilen freilich nur einer. Sie liefen
schnell, wie man läuft, wenn man das Ziel kennt und den Weg
täglich geht. Es war mehr als bloße Hast, es war, so schien
es mir, ein rechter Eifer in ihrem Gang, der Eifer der Guten, also gar
nicht nur etwas, das zum Vorschein kam, weil ein Mensch oder weil
mehrere Menschen zugleich heftig und gleichgültig, was eine
entsetzliche Mischung ausmacht, hinter ihnen einherschritten. Von
diesen Menschen ist zu sagen, daß, wie viele ihrer immer auch
waren, jeder einen Stecken in der Hand hielt, einen ganz kurzen, einen
Stecken weder zum Schwingen noch zum Trommeln, sondern zum Anspornen,
zum Stoßen. Wenn man nämlich genauer hinsah, war das eine
Ende des Steckens mit einer Blutkruste, einer dünnen,
überzogen oder einfach ein wenig noch blutig. Denn jeder Esel, ob
ihrer nun viele waren oder zwei oder einer, hatte auf dem linken
Oberschenkel des Hinterbeines, am Hinteren, wenn wir uns allgemeiner
ausdrücken, eine Wunde, verkrustet, halb verkrustet, nicht
verkrustet, und in diese Wunde fuhr flink der Stecken, sooft es der
Treiber für notwendig hielt, und zuweilen wohl auch, wenn er nur
zerstreut war. Dazu war der Stecken da und dazu natürlich auch die
Wunde: für den Stecken des Treibers. Wenn man so ein Dutzend Esel
durch die schmalen Straßen mit den tiefen Löchern darin
eifrig laufen sah, gedachte man wohl nicht immer gleich der Wunde oder
sah sie vielleicht auch nicht. Es darf zudem angenommen werden,
daß sie im Eifer des Laufens nicht gespürt wurde, und
ferner, daß zu einem nicht geringen Anteil dieser Eifer in all
seiner Auffälligkeit daher kam, daß durchaus jeder Esel eine
Wunde hatte. Ich wenigstens habe keinen ohne eine solche gesehen. Und
das ist auch der Grund, warum
256
mir
der Gedanke kam, ob alle diese Esel zusammen nicht etwas wie einen
Verein, einen Klub, eine Genossenschaft bildeten mit allerlei Vereins-
und Klubgefühlen, Überzeugungen und Voraussetzungen und ob es
weiter im Sinne des Vereines nicht für ausgemacht gelte, daß
diese Wunde am linken Hinterteil gar keine Wunde sei, sondern ein
Orden. Gleichgültig, ob sie im Verharschen begriffen und mit einer
Kruste bedeckt sei oder frisches Blut daran klebe. Warum sollte man
auch nicht darüber übereingekommen sein? Vermied man doch auf
solche Weise so üble Menschenbegriffe wie Gewöhnung und
ähnliches. Von denen man unter Eseln durchaus nichts wissen
wollte. Nur das nicht, lassen wir das doch ein für allemal den
Menschen, die, wenn sie so einen Esel, wie wir es sind, einhertraben
sehen, ausrufen: Oh, die spüren ja nichts mehr, die sind das schon
gewöhnt. Weg mit dieser Menschenrede! Wir Esel sind nichts
gewöhnt und bleiben darum genau.
Nun gut. Das sei alles zugebilligt. Jetzt machen wir aber den Versuch
und nehmen einen aus einer solchen Gruppe von eifrigen,
ruhmsüchtigen Ordensbrüdern heraus und fragen, was dann
geschehe mit diesem einzelnen, den wir herausgestellt haben aus der
Reihe. Die Hypothese mit den Orden ist bei all ihrer
Großartigkeit jetzt nicht mehr zu halten, was soviel heißt
wie, daß aus dem Orden wiederum eine Wunde geworden ist und
nichts anderes. Um so mehr, als so ein einzelner Esel jetzt dem Mann
mit dem kurzen Stecken sehr viel näher steht im Raum als die
Gruppe vorhin und es zu Verharschungen und Krusten nur noch sehr schwer
kommen dürfte. Die Wunde ist da und immer frisch, blutet und wird
als solche naturgemäß in jedem Augenblick empfunden, was
immer sonst Gewöhnung im Leben
257
mancher
Kreatur bedeuten mag. Die Wunde ist da, was soviel bedeutet wie,
daß der Eifer, der einmal die Gesamtheit erfaßt hatte,
gebrochen ist oder sich höchstens nur mehr noch als Eifer eines
Gebrochenen behaupten oder zu erkennen geben könne. Augenblicke,
ganze Zeitstrecken werden jetzt nicht vermieden, nicht umgangen werden
können, da solch ein Esel mit der Wunde (an Stelle des Ordens)
viel langsamer, mühsamer werde gehen müssen und da alle
Fortbewegung einher vor dem Mann mit dem kurzen Stecken ihn als eine
einzige, durchaus ununterbrochene Mühseligkeit dünken werde.
Mit solchen Augenblicken, vielmehr Zeitstrecken wird gerechnet werden
müssen. Freilich wird der dahintrabende Esel oft nur das
Gefühl haben, nicht mehr als das, daß er langsamer gehe als
seine Kameraden mit den Orden am Hinteren, zu denen er
schließlich gehört und von denen er aus Gründen, die
nicht weiter anzugeben sind, getrennt worden ist. Und da kann und wird
es geschehen, daß sich im Hinblick auf das genannte Gefühl,
auf diese — menschlich gesprochen — aus dem Wundsein geborene
Subjektivität ein neues Gefühl, nein: ein neuer innerer
Zustand im Kopf des Esels und von da aus in der Seele bildet, der
nämlich, daß er im Kopf und weiter in der ganzen Seele drei-
bis viermal so schnell sei als in den vier Beinen, daß er
sozusagen in einem fort über- und nachholen wird Weges- und
Zeitstrecken lang, ein innerer Zustand, von dem innerhalb der Gruppe
seiner Kameraden (mit den Orden) keine Vorstellung, auch nicht die
leiseste Vorahnung herrschen kann. An welchem inneren Zustand allein
die Wunde, die bis ins Fleisch geht, schuld hat. Ich habe nämlich
vorhin behauptet, daß so ein Esel sich nicht leicht an Inneres,
an Innerlichkeiten verliere, und Zwar um der Genauigkeit willen, mit
der sich bei ihm
258
in
Momenten schöner trommelhafter Anspannung Weisheit und Kitzel
ineinander fügen. Wenn ich also hier und jetzt vom Inneren rede,
so ist es kurz nur das Innere einer Wunde, die ins Fleisch geht, nicht
mehr, aber freilich auch nicht weniger.
Es ist nun nicht zu zweifeln, daß unser Esel mit der Zeit, bei
diesem Wechsel von Schnell und Langsam, Gut und Böse, einfach
auseinandergehen, zerreißen oder plötzlich einmal in zwei
Teilen daliegen, ausrinnen und um alle Substanz kommen
müßte, ja um die Seele selbst, das Seelenheil und was daran
hängt, wenn ihm, dem Esel, dem einen und auserwählten, Gott
jetzt nicht jene Einbildungskraft verliehen hätte oder verleihen
wollte, die notwendig ist, damit er ganz und nicht in zwei Teile
geteilt, entzwei gebrochen, am Wege liegen bleibe.
So ist dann die Einbildungskraft des einzelnen, Esel oder Mensch,
entstanden: aus dem Rhythmus der Gruppe, gleichwie dieser aus der
Magie, aus der magischen Zeit entstanden ist. Welche Lehre ich dem
marokkanischen Esel und niemand anderem verdanke.
Letzte Änderung: 13. August 2025