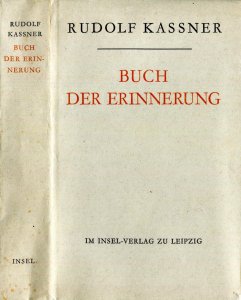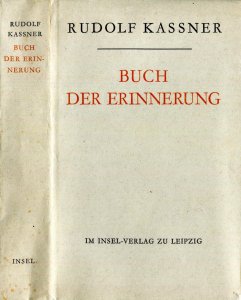RUDOLF KASSNER
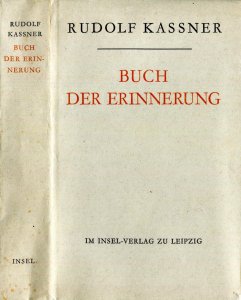 BUCH DER ERINNERUNG
1938
BUCH DER ERINNERUNG
1938
3. ERZIEHUNG
S. 84—169
84
ERZIEHUNG
1
Was hilft
mich die Wissenschaft, so ich darinnen
nicht
lebe? J a k o b B ö h m e
Ich bin im Herbst 1892 an die Wiener
Universität gekommen und habe meine Studien in den beiden
Semestern 1895/96 an der philosophischen Fakultät der
Universität in Berlin beendet. Das Doktorat wurde in Wien gemacht.
Die neunziger Jahre des verflossenen Jahrhunderts, die in einem
bestimmten Sinne bis zum Weltkrieg reichen und darum für uns heute
von besonderer Bedeutung sind, waren das Jahrzehnt (oder mehr als genau
ein Jahrzehnt) jenes Individualismus, von dem sich die Welt jetzt, die
Jugend vor allem, abgekehrt hat.
Ohne mir dessen in einem stärkeren Grade bewußt zu sein, bin
ich sicherlich ebenso Individualist wie alle anderen jungen Leute der
Zeit gewesen. Landkinder, wie ich eines war, leben von der Anschauung,
leben lange davon und gewinnen erst allmählich, schrittweise die
Begriffe für das, was sie berührt und bewegt.
Man war damals Individualist oder Sozialist, einige Gescheite freilich
versuchten beides zu verbinden. Viele von den Individualisten sind
später unter die Psychoanalytiker gegangen und viele von den
Sozialisten Kommunisten geworden. Ich habe gefunden, daß sich
Psychoanalyse und Kommunismus ergänzen, und ich glaube auch,
daß
85
mir der
Individualismus der neunziger Jahre von dem Augenblick anfing,
verdächtig zu werden, da er sich zur Psychoanalyse neigte. Mein
Verhältnis zu letzterer habe ich an so vielen Stellen meiner
physiognomischen Schriften klarzulegen versucht, daß darüber
hier kein Wort mehr verloren werden soll.
Es gibt so viele Individualismen, als es Nationen oder Rassen gibt: den
französischen, den ich den vernünftigsten oder, besser,
vernunftgemäßesten nennen möchte, den russischen bei
Dostojewski, der, religiös eingestellt, die Vollendung der
Individualität erst im Heiligen erblicken kann, den politischen
des Engländers, sich im Charakter, in der Gesinnung auslebend, und
endlich den leicht transzendierenden des Deutschen. Es scheint in der
Tat so, daß im englischen Wesen die Mischung von Menschentum und
Volkstum, von Erobererwesen und Traditionsgebundenheit am
glücklichsten gelungen ist, worauf wohl nicht zuletzt die
Bewunderung zurückgehen mochte, mit welcher vor dem Kriege auf
alles Englische hingesehen wurde. Entschieden hat der Deutsche
größere Schwierigkeiten gehabt, seine persönlichsten
Wünsche, Bestrebungen und Sehnsüchte mit dem Allgemeinen, mit
der Tradition in Einklang zu bringen. Weshalb auch sein
Individualismus, der verhängnisvollste von allen, stets auf der
Schneide lebt und bereit erscheint, überzugehen und sich in sein
Gegenteil zu verkehren.
War es doch der größte Geist des ausgehenden Jahrhunderts,
war es Nietzsche,
ein Deutscher, welcher den Begriff des Ressentiments
beinahe erfunden, auf alle Fälle herausgestellt hat als das
Ergebnis einer nicht ganz gelungenen Mischung oder besser: der
bedeuteten Schwierigkeit beim Mischen von solchen Gegensätzen
86
wie
Individualismus und Nationalismus, als die Folge einer nicht leichten
seelischen Verdauung und verwandter Erscheinungen mehr. Die menschliche
Persönlichkeit dieser Epoche war in der Tat nicht ganz durch, wie
man von einer Speise, vom Fleisch sagt, daß sie nicht durch
seien. Das hat mich sehr früh betroffen: dieses Nichtdurchsein der
Persönlichkeit, und ich hatte mir den Vergleich bald angeeignet.
So eine Persönlichkeit war auch nie recht zu fixieren, weil sie
sich nach ihrer eigenen Angabe dauernd in Entwicklung befand und
gewissermaßen an Baal, den Götzen des Propheten, gemahnte,
an welchen man sich darum, wie es hieß, nur schwer wenden konnte,
weil man nie wußte, ob er ,nicht auf Reisen sei heute oder
augenblicklich schliefe und nicht zu wecken wäre‘. Da lebte im
Lande so eine große, sehr publike und ihre Publizität stets
von neuem eifrig auffrischende Persönlichkeit, die zunächst
einmal was war? Gegen die Stadt und für das Land, das Dorf, die
Berührung mit der Erde, die Dichter, darunter freilich auch
für solche, die ausgesprochen Städter waren. Dann im
gegebenen Fall für das Russische, die Generosität und Breite
der Russen gegen das Deutsche ausspielend, das allemal knapp sei und
rechthaberisch. Der Beginn des Krieges brachte augenblicklich einen
Umschwung in der Gesinnung und dementsprechend auch eine Erklärung
in Form einer Broschüre. Nach dem Kriege wurde das Kommunistische
Manifest gelesen und öffentlich das Geständnis abgelegt,
daß man es bisher vierzigmal, wenn nicht öfter, hundertmal
gelesen habe und jederzeit mit einem Gewinn für sich selber und
damit hoffentlich auch für die Welt. Und so ging es fort. Der
Verkehr der Gläubigen mit dem Götzen war, wie man sieht, auch
jetzt nicht leicht, denn der Gläubige stieß, wenn wir uns
das Zeitliche in ein Räumliches
87
übersetzen,
oft auf ganz leere Stellen dazwischen, auf solche, auf welchen Baal,
erzählen die Leute, wohl eben geweilt habe, auf denen aber im
Augenblick ganz bestimmt nichts mehr zu finden sei.
Frank Wedekind
war sicherlich ganz und gar kein Götze, er war in manchem
vielleicht nur ein rührender Mensch mit einem wahren Aberglauben
an den Erfolg. Als ob ein Mensch ohne Erfolg auf kaum mehr im Leben
Anspruch hätte denn auf Lächerlichkeit oder die Anstellung
als dummer August im Zirkus. Er ist mir aber stets als eines der
eindrucksvollsten Beispiele erschienen für jenen oben genannten
Zustand des Nichtdurchseins. Nur bei einem Deutschen aus dieser Epoche
war ein solches Zusammentreffen von unzweifelhafter Genialität und
ebenso unzweifelhaftem Philistertum zu beobachten oder konnte die
Sprache zugleich so neu, so erregend und doch so papieren sein wie in
den Dialogen der Stücke Wedekinds. Was alles in seinem Gesicht
deutlich wurde, sooft er mit seiner kleinen, spitzen, dunkelroten Zunge
im Munde hin und her zu züngeln begann. Das Gesicht hatte wohl
etwas von einem Teufel, aber noch mehr von einem Mann, der, sagen wir
so, abends an der Kasse sitzt eines Theaters, eines Zirkus oder auch
nur einer gewöhnlichen Schaubude, um Billette zu verkaufen. Ich
bin ihm einigemal am Tische meines schon erwähnten Freundes Eduard von
Keyserling in München, abends im Restaurant, begegnet, so um
die Jahrhundertwende. Eduard von Keyserling der war durch, man
möchte sagen, zu sehr durch.
Eines Abends erzählte Wedekind, der eben aus Leipzig gekommen war,
von einer Frauenstatue Max Klingers, der
in diesen Jahren noch neben Michelangelo genannt wurde, von manchen
vielleicht nur wegen seiner sehr
88
ausgiebigen
Potenz, die an sich damals hoch in der Schätzung der Geister
stand. Die Frauenstatue sei, sagte Wedekind, ohne Arme, und Klinger
lege in den Körper der Armlosen alles Verlangen, alles
Ansichreißen und Sichhingeben einer Umarmenden hinein. Das war
natürlich durchaus das, was man brauchte und suchte, man horchte
auf, Wedekind machte sein züngelndes Teufelsgesicht, Keyserling
trank ihm aus seinem Glas mit Rotwein zu, nur ich erlaubte mir die
Bemerkung, daß der Marmor zu diesem Frauenkörper, von dem
ich schon gehört hätte, von einer Tempelsäule stamme,
die Klinger in Griechenland gefunden habe, und daß sich wohl
daraus die Armlosigkeit des Frauenkörpers ohne weiteres von selbst
ergebe. Ich wollte ja Wedekind keineswegs widersprechen, war nicht ohne
Sinn für das Verlangen dieser armlos Umarmenden, nicht im
mindesten, hatte gewiß auch eine ziemlich deutliche Vorstellung
davon in meinem Geiste, ich wollte Wedekinds Deutung nur ergänzen
und von der anderen Seite, vom Objekt her auch begründen. Wedekind
wollte aber keine Ergänzung, hörte darin nur den Widerspruch
und zischte gegen mich los.
Was er nicht vermochte, war beides zusammen sehen: seine Deutung und
meine Erklärung. Dazu hat es ihm an innerer Freiheit, an
Generosität gefehlt, dazu war er irgendwie auch zu
abergläubisch auf seine Weise. Und doch kommt Freiheit erst in
Frage, wenn einer beide Seiten im Leben zu sehen die Kraft und den
Willen hat. Weshalb nur der frei genannt werden darf, der durch ist, um
dieses Bild noch einmal zu gebrauchen.
2
Wenn wir von einer Lehre Stefan Georges
— der durchaus ein Mann der wilhelminischen Epoche war: nämlich
89
deren
Widersacher — reden dürfen, so war sie gegen Richard Wagner,
gegen
dessen von der Musik her orientierte Weltanschauung, Art und Haltung
gerichtet. Und doch besteht eine tiefe Verwandtschaft zwischen beiden
und erscheint die Seele Richard Wagners, des entschieden
größeren, machtvolleren von den zweien, in der Seele Stefan
Georges wiedergeboren und verwandelt. Was wiederum nur damals und unter
Deutschen in der Ära des Individualismus denkbar war: daß
man aus derselben Wurzel komme, eine ähnliche Art habe und doch
gegeneinander stehe. Physiognomisch wurde einem das deutlich bei einer
Betrachtung des gleichen Verhältnisses zwischen beider
mächtigem Schädel und beider kleinem, magerem, ja armseligem
Körper. Nur waren Schädel und Gesicht bei Richard Wagner mit
dem meermuschelhaften Schwung von der Nasenwurzel an bis in den Nacken
hinein die eines Ohrmenschen von höchstem Rang und sinnbildhafter
Kraft, während die prachtvoll gemeißelte Stirn Stefan
Georges — einer seiner Freunde und Schüler bezeichnete sie mir
gegenüber als Tierstirn des Genies, was gewiß noch
schöner klingt, als es stimmt — den plastischen Wortbildner, den
größten seiner Zeit, verriet. Als physiognomisches Kuriosum
erschien mir daneben die Stirn Friedrich
Gundolfs, sie war wie das Junge der Stirn Georges: nur dünner,
weicher, durchsichtiger. Eine Zeit lang hat es so scheinen können,
als ob das Gesicht des Meisters sich in das seines Schülers und
Jüngers eingedrückt, hineingebohrt hätte, was
später aus letzterem dann verschwand. Einem ähnlichen
Phänomen wird man im Laufe der Geistesgeschichte wohl kaum
begegnet sein.
Ich bin mit Stefan George nur einmal zusammengetroffen, 1904 bei Hugo von
Hofmannsthal in dessen Haus
90
zu Rodaun.
Friedrich Gundolf, den Meister auf der Reise begleitend, war dabei.
George hatte einmal die Absicht gehabt oder hatte sie noch, meinen
Aufsatz Die Ethik der Teppiche, aus den Essays, als
Sonderabdruck im Verlag der ,Blätter für die Kunst‘
herauszugeben, war von meinem Buch über die englischen Dichter,
das damals noch einen anderen Titel führte, eingenommen gewesen,
hatte oft, wie man mir erzählte, daraus vorgelesen, und so sollten
wir uns einmal sehen, was eben in Rodaun geschah. Ich war infolge von
Tratsch und Gerüchten, die um George stets im Schwange waren, auf
ein sehr priesterliches Gebaren seinerseits gefaßt, doch nichts
davon trat zutage, er war der denkbar einfachste Mensch in seinem
blauen, etwas spiegelnden Anzug und der hohen Kragenkrawatte, aß
ununterbrochen, auch nachdem der Tee serviert worden war, Sandwiches
und drehte sich zwischendurch aus türkischem Tabak selbst mit
seinen vom Nikotin gebräunten Fingern die Zigaretten, was man
damals noch in Frankreich und in Österreich zu tun pflegte. Er las
uns aus seiner Dante-Übersetzung vor: murmelnd Wort an Wort
reihend, jedes Pathos vermeidend, als läse er Zauberformeln,
Gebete vor in einer Sprache, die niemand zu verstehen brauche, weil sie
heilig und zu rein magischen Wirkungen bestimmt sei. So wird in den
Moscheen Arabisch vorgelesen oder gebetet, das niemand sprechen kann
von den Knieenden. Es war eindrucksvoll, wenn auch nicht ganz
befriedigend. Rilkes
Vorlesen verstand beides zu vereinigen: das Priesterliche und das
Dramatische. Es vermochte einen aber über das Verhältnis
Georges zur Musik aufzuklären. Ich stand damals noch sehr im Bann
der Musik Richard Wagners, wovon auch die erste Auflage der Moral
der Musik Zeugnis ablegen kann. Davon wollte George nun nichts
91
wissen; er
wurde ganz böse, als ich ihn, nicht ohne die gebotene Deferenz,
nach seiner Stellung zur Musik und so weiter fragte. Das könne er
mir jetzt nicht in fünf minuten erklären, auf jeden Fall sei
sie ganz anders als die meine.
Vor dem Abschied mußten wir uns noch ins Fremdenbuch eintragen.
Zuerst kam natürlich der Meister daran, der nur St. G.
hineinschrieb. Als Gundolf ihm in der Reihe folgte, der den ganzen
Nachmittag über kaum den Mund aufgetan hatte und nur von Zeit zu
Zeit mädchenhaft errötete, sooft man sich an ihn mit Blick
oder Rede wandte, rief George: Dischtanz halte, Gundel, Dischtanz! Nach
Jahren wurde mir diese kleine, an sich ganz bedeutungslose Szene so
wiedergegeben, als hätte George den Ausruf: Dischtanz halte,
Gundel, drohend, befehlend getan. In Wirklichkeit sagte er es scherzend
und sich ein wenig lustig machend über die Verschämtheit und
die zögernde Bescheidenheit des Jüngers, wohl auch über
sich selber, soweit so etwas überhaupt vorstellbar ist. So werden
Geschehnisse weitergegeben.
Menschen mit einem sehr klaren Blick für das einfach Menschliche
finden Georges Bild in meiner Physiognomik eitel. War George
eitel? Ist ,eitel‘ nicht ein dummes, unwichtiges Wort einer so
bedeutenden Erscheinung gegenüber? Stefan George war eitel, wie
nur ein Deutscher, vielleicht auch ein Inder, ein Bengale, eitel sein
kann, was soviel heißt wie, daß die Eitelkeit hier unter
die Haut dringt. Weshalb sie vielleicht im Bild mehr heraustritt als in
der Wirklichkeit. Persönlich wirkte er ganz und gar uneitel,
hingegen nicht gesund, livid, gleich einem, der Empfindungen zu
überspannen liebt. Sein grünlichblaues Auge war klein und
konnte zuweilen sehr böse dreinblicken, war überhaupt eher
böse. Die Eitelkeit
92
Baudelaires,
den George bewunderte, war Koketterie, Bluff, Dandytum, löste sich
leicht ab oder ließ sich wie gute Schminke abwaschen. Die
Eitelkeit des Individualisten aber geht nicht so leicht weg und sieht
oft wie ein Leiden aus. War aber George Individualist? Seine Lehre ist
offenbar gegen den Individualismus. Und doch war er es, und das brachte
bei ihm das hervor, daß er zugleich eitel und leidend erschien
oder auch war.
Ich habe vorhin den deutschen Individualismus transzendierend genannt.
Das hängt zweifellos aufs allerengste mit der deutschen Sprache
zusammen, die eben um des Transzendierenden, Hinübergreifenden
willen so menschlich ist. Wie anspruchsvoll ist nicht das Wort:
Persönlichkeit! Wie hoch wollen wir damit nicht hinaus, über
uns selbst hinaus und hinweg, so hoch, daß einem hinterher oft
nichts anderes übrig bleibt, als auf uns zurückzufallen, ja
darunter zu gehen und uns zu genieren! Houston
Stewart Chamberlain hatte die Gewohnheit angenommen,
Persönlichkeit mit großer Persönlichkeit zu verwechseln
und zum Teil darauf, auf etwas also, das wie ein Trick aussehen konnte,
seine politischen Anschauungen aufgebaut. Ich habe einmal versucht, ihm
das klarzumachen. Als Deutscher. Da brach aber plötzlich der
Engländer bei ihm durch, der das nicht wahrhaben wollte, und zwar
aus einer gewissen natürlichen Anlage zum politischen Denken. Es
sei eben richtig und gut, den Menschen ein Bild, ein
vergrößertes, vorzuhalten, sie damit anzuspornen, zu locken.
In Chamberlain war ein Pragmatist versteckt. Pragmatismus, von England
und Amerika geliefert, ist im besten Fall die Philosophie von
Politikern. Ich war aus Instinkt, möchte ich sagen, gegen jede Art
von Pragmatismus, von Als ob. Er ist mir stets billig, ja schäbig,
entschieden unheroisch
93
vorgekommen,
als ein Zeichen einer präformierten Verkalkung des Geistes, zudem
auch falsch.
3
Sicherlich kommt der deutsche Individualismus ebenso wie der
griechische aus dem Idealismus. Beide Individualismen sind geistiger
Art zum Unterschied vom englischen, der mehr seelisch ist. In dem
Jahrzehnt aber, darin ich geistig geweckt werden sollte, stand der
Individualismus dem Idealismus sehr unversöhnlich gegenüber.
Man war Idealist ebensowenig wie liberal. Die Väter, heißt
das, waren noch liberal gewesen, die Söhne sind es nicht mehr,
sind allerhand statt dessen und dagegen. Wenn man will, kann man im
Liberalismus unserer Väter einen Übergang, eine Vermittlung,
eine Mittelmäßigkeit sehen: vom Idealismus zum
Individualismus, zwischen dem einen und dem anderen. Der Individualist
wollte aber in diesen Tagen ebensowenig mittelmäßig wie
Idealist sein; man ist versucht zu behaupten, daß er sich darauf
hatte ein Patent geben lassen, im Idealisten Spuren des
Mittelmäßigen und, umgekehrt, im Mittelmäßigen
solche von Idealismus entdeckt zu haben. Was wollte er aber nun
wirklich sein, was war er in Wirklichkeit? Psychologe und zugleich
Realist. Eines schien ihm mit dem anderen gegeben und durch das andere
hervorgerufen. Die Zusammenfassung aber aller Bestrebungen,
Wünsche und Ziele schien in der Figur Henrik Ibsens in
Erscheinung zu treten, weshalb es auch so aussah, als ob bei den
Erstaufführungen Ibsenscher Stücke in den neunziger Jahren
der Geist in Person zu Wort gekommen wäre, und zwar ein für
allemal.
Die Figur Ibsens war mehr als irgend eine andere zu einer Art Mythos
geworden, nicht trotz, sondern mit
94
allen ihren
kleinen, überaus menschlichen Eigentümlichkeiten und
Skurrilitäten. Darin lag eine gewisse Kraft: in dieser Verbindung
des Geheimnisvollen mit dem Schrullenhaften. Daß er im Zylinder
innen einen kleinen Spiegel angebracht hatte oder daß
gelegentlich Kritiker den von allzuvielem Rotwein Wankenden nachts nach
Hause begleiten durften, das tat dem Mythischen seiner Person in keiner
Weise Abbruch.
Ich sage: Kritiker. In der Tat ist vielleicht zu keiner Zeit der
Kritiker in seiner Position zwischen dem Dichter und dem Publikum so
wichtig, so entscheidend und auch so berühmt gewesen wie in den
neunziger Jahren. Ich erinnere mich sehr genau all dieser
Ibsen-Erstaufführungen meiner Studentenzeit in Wien und in Berlin.
Die Kritiken erschienen nachher, das verstand sich von selber, sie
erschienen aber auch schon vorher. Vorher u n d
nachher. Ich kannte einen gescheiten Mann, der dazu vom Schicksal
berufen zu sein schien, sehr ausführliche und tiefsinnige Artikel
über das zu erwartende Stück eine Woche oder mehr vorher zu
veröffentlichen. Es ging vor allem anderen um das Symbolische im
,Baumeister Solneß‘, in ,Klein Eyolf‘, in der ,Frau vom Meer‘,
und dazu besaß er allein oder zunächst die Schlüssel,
so schien es wenigstens. Nun ist die Symbolik Ibsens meist entweder
geschmacklos oder platt, darauf war man ja mit der Zeit gekommen, und
darüber hatte man sich auch irgendwie beruhigt. Mein Kritiker
schien sich aber diese Entdeckung so zu Herzen genommen zu haben,
daß er später überhaupt nichts mehr schrieb im Leben,
denn ich bin seinem Namen in keiner Zeitschrift mehr begegnet, so
daß mir manchmal der Gedanke kam, ob er nicht daran gestorben
sei. Was ich nicht hoffe, was ich zu keiner Zeit gehofft habe und dann
nur hätte wollen können,
95
wenn ich ein
Ibsensches Symbol und nichts anderes gewesen und mir der Wunsch
freigegeben worden wäre nach einem Menschen, einem Wesen, das aus
Mitgefühl mit mir hätte dahingehen wollen in die
Vergessenheit.
In diesen Jahren war es auch, daß die Idee des
schöpferischen Kritikers konzipiert wurde. Zum Unterschied von
irgendeinem, sagen wir: unberühmten. Man schien vielfach in
Gedanken mit der Frage beschäftigt, wann etwa und unter welchen
Voraussetzungen ein Kritiker einem Dichter an Wert, an Ewigkeitswert
gleichkomme, ob etwa nicht ein sehr guter Kritiker doch um einiges mehr
als ein wenig guter Dichter, um uns in einer so heiklen Angelegenheit
nicht bestimmter auszudrücken, oder ob sich so etwas wie eine
Gleichung ansetzen ließe zwischen diesem sehr guten Kritiker und
einem gut mittleren Dichter, wenn Mittleres hier überhaupt noch
Geltung haben könne. Was damals nicht so ohne weiteres hingenommen
worden wäre. Solche Gleichungen aber sind schwer aufzulösen;
in den meisten Fällen blieb es bei kolossalen Eitelkeiten,
mußte es dabei bleiben und noch bei dem, daß man einen
geringen Dichter gelegentlich mit der Feder schöpferisch
niedermachte.
In dem Jahrzehnt des Individualismus fehlte es keineswegs an Talent, o
nein, aber an der Idee und Vorstellung von Art. Das gab es nicht, das
wurde auch nicht in den Mund genommen: Art. Es gab Großes, es gab
Kleines und zwischendurch Persönlichkeit, aber nicht das, was wir
Art nennen. Die Psychologen, die damals das große Wort zu
führen begannen, hatten erst recht kein Interesse daran, und die
Psychoanalytiker gingen schließlich darauf aus, Art zu
zerstören oder von vornherein nicht gelten zu lassen. Man
bewunderte und liebte auch dies und jenes:
den Dichter, die Natur, London, Paris,
96
und war doch
nicht ohne Neid und Mißgunst. Art ist aber bestimmt dazu da, das
auseinanderzuhalten: die Bewunderung und den Neid oder ähnliches.
Und wenn das alles nicht auseinandergehalten werden könnte, so
würde es auch keine Art geben oder müßte man derselben
entbehren.
Wie war uns damals Berlin nicht wichtig und maßgebend, uns, die
wir aus Wien oder Graz kamen! Ich kannte einen Grazer Studenten, der
zwei Semester lang mit entzückten Blicken durch die Straßen
Berlins, auch durch die Friedrichstraße, langbeinig
einherschritt. Ich erinnere mich so eines abendlichen Spazierganges
unter den Linden im Juli kurz vor Schluß meines letzten Semesters
dort. Mein Begleiter war ein rechtskundiger Mann, älter als ich,
schon im Amt, ein lieber, im letzten auch bescheidener und
wohlgesinnter Mensch, nicht ohne allgemeine Bildung, den Klassikern der
Schule Treue bewahrend, auf seiner Reise durch Sizilien einen Thukydides in der
Ursprache im Koffer mitführend. Er war Junggeselle, und seine
extreme Kurzsichtigkeit wußte er bei Gelegenheit mit einem
überlegenen Zwinkern unter sehr dicken Brillengläsern
zuzudecken. Es war unvermeidlich, im Gespräch wieder einmal darauf
zu sprechen zu kommen, ob Berlin und wann es London oder Paris
erreichen oder gar übertreffen werde an Größe,
Reichtum, Schönheit und Weltwichtigkeit. „Sie haben ja Ihre alte
Kultur“, meinte er zu mir, damit den Wiener von vornherein aus dem
Wettbewerb ausschließend. Dann kam, weiß ich noch, zur
Sprache, daß Fontane,
dessen Effi Briest und Irrungen, Wirrungen derzeit viel
gelesen wurden, eine so vornehme Art habe, welche anderen,
jüngeren, fehle, gewisse Dinge zu übergehen, Dinge, die
geschehen, geschehen müssen, die man aber erraten könne. Man
ißt
97
abends im
Restaurant am See, beim ersten gemeinsamen Ausflug, Schleie in Butter,
am Morgen danach trinkt man auf der Terrasse, den See vor sich im
Sonnenglanz, Kaffee, sie streicht die Semmeln. Was brauchte es da
weiter umständlicher Erläuterungen, eingehender Schilderungen
von Dingen, die wir alle kennen und erlebt haben? Gewiß, er hatte
recht, aber ganz habe ich vielleicht doch nicht begriffen, kommt mir
jetzt vor, warum er eine gar so große Befriedigung darüber
empfunden hatte, daß ,alles‘ stets übergangen werde.
Plötzlich aber war er darauf gekommen, daß er keinen
Unterschied mache zwischen einem Dichter wie Gerhart
Hauptmann und
sich, dem Rechtsanwalt, wie immer die Welt sich dazu stellen möge,
er sei ebensoviel oder ebenso groß. Er sagte das so von der Seite
her, aber es war darum nicht weniger aufregend, aufreizend. So
daß ich unmittelbar das Bedürfnis empfand, etwas zu
erwidern. Etwa: es käme dabei doch wohl auch auf die Welt an, wie
immer diese Welt sei oder wir sie einschätzen und wenn sie sich
auch beim Anblick der Großen nicht durch mehr als durch
Fingerzeige, Flüstern, Ins-Ohr-Tuscheln zu manifestieren die
Fähigkeit besitze. Oder: hoffentlich bleibe auch Gerhart Hauptmann
groß und passiere ihm später nichts. Schon Ihretwegen. Doch
ich sagte lieber nichts und blickte auf den Boden. Es war besser so.
Als ich aber nach einer Weile sehen wollte, wie er sich nach einer so
kühnen, ja herausfordernden Erklärung befände, blickte
auch er auf den Boden, und so wurde weiter nicht mehr von
Größe unter uns gesprochen.
4
Eine kleine Episode, die immerhin zeigt, wie der Künstler und der
Kritiker damals aufeinander eingestellt waren.
98
Eines
Sonntags, am Nachmittag, es war im Herbst 1910, mietete Rilke ein Auto,
ich sollte mit ihm nach Meudon zu Rodin, wir
würden erwartet. Am Eingang der sehr berühmten und vollkommen
unschönen Villa kam uns ein altes, fast kümmerliches Weiblein
in den Weg, das ich für die Frau des Concierge nach seinem
Aussehen und der Kleidung halten mußte, bis mir Rilke, nachdem er
es mit großer Höflichkeit begrüßt hatte, ins Ohr
flüsterte, daß es Frau Rodin selber wäre. Von welcher
uns auch gleich angezeigt wurde, daß der Meister sehr
verkühlt sei und uns darum nicht im Atelier, sondern oben im
Schlafzimmer empfangen werde. So ging es also erst eilig durch die
vielen und geräumigen Säle mit Statuen, Büsten, Studien
in Gips hindurch, Rilke machte den Führer, vielleicht zu schnell,
das meiste war uns beiden schließlich bekannt, und wir wollten zu
ihm, dem Schöpfer, mehr als zu dessen Werken. Wir trafen ihn dann
auch oben an, neben seinem Bett in einem Empirefauteuil sitzend, die
beiden auffallend dicken, ungeformten Hände auf den vergoldeten
Sphinxen der Lehne lastend. Das ganze, nicht große Schlafzimmer
war Empire. Lauter sehr schöne Stücke, von ihm selber
gesammelt. Es war aber zwischen den einzelnen nichts, keine Luft,
Stück stand neben Stück, Ding neben Ding. Auch er war so wie
ein Stück da, ein Stück großer Meister, im Fauteuil
sitzend, welcher etwas von einem Thron hatte. Das schien sehr
merkwürdig bei einem Künstler, und ich habe es mir daraus
erklärt, daß Rodin sein Leben im Atelier gelebt habe,
daß das Atelier seine Welt gewesen sei, so sehr, wie diese es nie
für Michelangelo, noch weniger für Donatello oder die Meister
der Kathedralen war. Und so standen auch diese kostbaren Möbel
neben- und gegeneinander wie Gegenstände im Atelier: unverbunden,
vor-
99
läufig,
zufällig, als ob das wahre, das lebendige Leben für die Dinge
nur in der Seele und im Geiste des Schöpfers gelebt werden und
daraus allein alle Verbindung und Verbindlichkeit für die Dinge
draußen geholt werden dürfte.
Mit sehr heiserer Stimme, voller Schnupfen und
Niesen, begann nun Rodin alles das über seine Kunst, über die
Kunst überhaupt zu sagen, was man aus seinen eigenen Büchern,
aus den vielen anderer über ihn lange schon kannte; er sagte es
her, sagte es auf, zwischendurch niesend, und wandte sich dabei an
mich. Was schließlich ganz begreiflich war. Rilke hatte ihm
nämlich gesagt oder geschrieben gehabt, daß ich vor Jahren
einmal über ihn einen Aufsatz veröffentlicht hätte, er
durfte oder konnte mich also für einen Kritiker halten, für
den Mann einer ausländischen Revue oder Zeitung. Plötzlich
aber hielt er inne, fuhr in seinem Auf- und Hersagen nicht mehr fort,
einen schnellen Blick aus schlau verdutzten Augen auf meine Hände
werfend, die völlig müßigen, unbewaffneten, und sagte
bis zum Abschied nur noch Gleichgültiges, von nun an mehr zu Rilke
als zu mir gewandt.
Ich konnte mir es nicht erklären, bis Rilke,
vom Ganzen ein wenig enttäuscht, mir auf der Rückfahrt
eröffnete, Rodin hätte mich sicherlich für einen
Journalisten gehalten oder einen Mann einer ausländischen Revue,
irgendeinen, und sich gewundert, daß ich das, was er sage, nicht
mitschriebe. Daher sein Blick auf meine Hände ohne Bleistift und
Notizbuch. Zu Rodin hatten in der Tat die Kritiker dazugehört; man
erzählte damals in Paris, daß alle ein wenig gesuchten Titel
seiner Skulpturen von Männern der Feder herkämen, daß
zum Beispiel der Titel Penseur jener Männerstatue mit dem
ge-
100
waltigen
Rücken und dem kleinen Kopf eines Ringers von Octave Mirbeau
stamme. Rodin selber wäre eine solche Benennung nie eingefallen.
Und doch war kurz vor dem Weltkrieg das Verhältnis zwischen
Künstler und Kritiker locker geworden. Im Jahre 1912 habe ich Maillol oft
in dessen Atelier besucht. Von Kritik, Kritikern war nicht mehr die
Rede.
Der Herbst des Jahres 1910 war aus zwei Gründen für mich
bedeutsam. Erstens begründeten er und das vorangegangene
Frühjahr meine Freundschaft mit Rainer Maria Rilke, den ich
früher nur einmal gesehen hatte, da er mich zwei oder drei Jahre
zuvor in Hietzing besuchen kam. Wir sahen uns jetzt zeitweise
täglich und oft von Mittag an, da wir zusammen in einem kleinen
Restaurant irgendwo frühstückten, bis spät in den Abend
oder gar in die Nacht hinein, die letzten Stunden bei einer Camomille
im Café
de la Paix zubringend. Mit Rilke kam es selten zu Diskussionen
irgendwelcher Art, sondern es war meist so, daß der eine
erzählte oder beschrieb und der andere zuhörte. Rilke konnte
ebenso trunken zuhören wie sehend erzählen. Sein ganzes Wesen
war durchsetzt mit Charme und Hingabe, was sollten da Diskussionen!
Er hatte eine Einladung zu einer Reise nach Algier und Ägypten
erhalten, die er mit geteilter Empfindung aufnahm. Ich sollte nun
entscheiden, ob er die Einladung annehmen solle oder nicht,
während er mit einem vor Unentschiedenheit, Wollen, Nichtwollen
und Tränen aufgedunsenen Gesicht bei mir im Hotelzimmer saß
mitten unter Wäsche, Kleidern und Büchern, die alle in zwei
Koffer sollten, da ich unmittelbar vor meiner Abreise stand. Ich
entschied: Ja. Reisen Sie! Nehmen Sie an! Nach Monaten schrieb er mir
dann nach Wien ungefähr
101
so: Lieber
Kassner, wenn ich die ganze Zeit über statt die schönsten
Dinge zu sehen in einem Pariser Hospital gelegen hätte mit dem
Gesicht gegen die Wand, so würde ich ebensoviel von allem gehabt
haben und ebenso glücklich gewesen sein.
Zweitens aber habe ich damals in Paris die Elemente der menschlichen Größe
beendet, die ich in der Bretagne, in St. Lunaire, bei Ebbe auf den
dunklen Steinen des Meeresstrandes sitzend, begonnen hatte. Mit diesem
schmalen Bändchen, das ich einem der wunderbarsten Menschen meines
Lebens, dem Gatten der durch ihre Freundschaft mit Rilke bekannten
Fürstin Maria
von Thurn und Taxis, gewidmet habe, glaubte ich mit Recht die
Periode meiner Jugendproduktion zu beschließen und eine neue der
Reife zu inaugurieren. Wir Deutsche sind entsetzliche Überwinder,
ewige Überwinder, und in den ‚Elementen‘ wollte ich aus dem
Antithetischen, das jeder Jugend anhaftet, heraus zu dem, was ich
Maß nannte oder was mir zum ersten Male als Maß aufgegangen
war. Ich begann alles Antithetische und die ganze, mir zu billig
erscheinende Kompensationspsychologie,
die damals im Schwange war, zu hassen und darin das sichere Anzeichen
von Maß- und Artlosigkeit zu erblicken. Ich
hatte das Gefühl, daß Größe,
Menschengröße ohne Maß, Maßeinheit, daß
Persönlichkeit ohne Art, Persönlichkeit als Parade, mir
nichts, dir nichts, sinnlos sei. Wo Maß ist, dort ist auch Art.
Beides muß gespürt werden. Die bloße
Individualität ohne Hintergrund bleibt ein spiel von Antithesen,
ist leck und indiskret.
Die Welt, die ich kannte, schien mir damals voll von solchen etwas
lecken, durch und durch indiskreten Persönlichkeiten.
Persönlichkeiten, die meinten, es so zu sein, wie sie Fritz oder
Kurt hießen und ein rotes Hemd
102
anhatten.
Es war mir einmal gelungen, zwei Verleger von großem Ruf bei mir
zu versammeln, unter ein Dach zu bringen. Nachdem der eine von beiden,
der weltläufigere, sich von uns verabschiedet hatte, sagte der
andere eher ungeniert, ja kühn, wenn man will: Ihr Freund ist ja
sehr tüchtig und gescheit, hat auch meist Erfolg mit seinen
Büchern. Bei mir aber, sehen Sie, stehen die Dinge anders: ich bin
zunächst Persönlichkeit. Ich schrie: Mein lieber D., Sie sind
ein Idealist, das ist es. Doch das wollte man nicht hören, auf
keinen Fall. Man war nicht mehr Idealist, oder wenn man es war, so
verschwieg man es, obgleich man sehr wohl hätte sagen können
und noch dazu ohne Verletzung des guten Geschmackes: Ich bin Idealist.
Statt dessen aber: Ich bin eine Persönlichkeit und so weiter,
worin doch die denkbar unglücklichste Eröffnung zu was immer
in der Welt lag.
Ein boshafter Mann schrieb mir ungefähr um dieselbe Zeit aus
Berlin, er habe unlängst bei Soundso, einem geistreichen, in
mancher Hinsicht bedeutenden Mann der Industrie, der Feder,
Verwaltungsrat unzähliger Gesellschaften und so weiter, ein Diner
mitgemacht, zu welchem, damit das Dutzend voll sei, die elf
gescheitesten Männer von Berlin geladen gewesen wären.
Gewiß war der eine oder andere nicht dabei, aber immerhin
saßen zwölf an der Tafel, und alle waren sehr gescheit und
hielten sich auch dafür. Leider sei beim Ganzen nicht viel
herausgekommen, denn keiner hätte dem anderen getraut, und alle
hätten einander mit der Frage angesehen: Bist du wirklich eine
Persönlichkeit? Ich kenne dich doch. Sind wir es wirklich alle?
Oder ist es am Ende keiner? Und ist die einzige wirkliche
Persönlichkeit draußen geblieben?
103
5
Eines darf nicht übersehen werden und ist zudem sehr
aufschlußreich, daß Persönlichkeit ein mittel- und
norddeutscher, ein protestantischer Begriff ist und das bloße
Wort in Österreich, im katholischen Süddeutschland selten
gebraucht wurde. Hier hat es genügt, daß einer jemand, sehr
jemand oder niemand, sehr niemand sei. Was alles letztlich auf die
reichere Struktur des Gesellschaftlichen, des Katholischen und manches
andere daneben zurückgeleitet werden muß. Man war
Persönlichkeit, ohne weiter einen Begriff oder eine Vorstellung
davon zu haben. Der letzte unter den Menschen Nestroys hatte
irgendwie Persönlichkeit oder war eine wenn auch überaus
lächerliche Persönlichkeit, aber es ist gar nicht zu denken,
daß Nestroy selbst das Wort je in den Mund genommen hätte.
In dem Jahrzehnt oder in den zwei Jahrzehnten des Individualismus aber
war das gesellschaftliche Gefüge gelockert, der reine Begriff des
Katholischen getrübt, Katholisches und Protestantisches nicht
zuletzt dank dem Einfluß Richard Wagners durcheinandergebracht
worden, und so konnte das, was sich als Persönlichkeit und sonst
nichts durchsetzen wollte, zur Geltung kommen oder seine neue
Bestimmung finden. Die norddeutsche Persönlichkeit hatte es, wie
ich schon angedeutet habe, mehr auf Entwicklung abgesehen, so zwar,
daß dabei ein Ende nie recht abzusehen war, ja ein solches im
gegebenen Fall leicht kläglich werden konnte. In Wien hingegen, um
dabei zu bleiben, wurde von denen, die ihre Wünsche in Prosa oder
in Versen zu äußern verstanden, derjenige gerne als
Persönlichkeit bezeichnet, qui
brûle la chandelle aux deux bouts, der Mann also, der die
beiden Enden der Dinge geschickt in die Hände bekommt, der
104
Mann
des Tiefsinns und des Lebensgenusses oder der Leidenschaft. Man nehme,
welche Gegensätze immer man wolle.
Es war so um die Mitte der neunziger Jahre, ziemlich genau, daß
Wiens berühmtester Kritiker und Ankündiger neuer Richtungen
und Stellungen des Geschmackes und des inneren Lebens der Seele von
Paris, wohin er sich zur Orientierung auch für andere zeitweise zu
begeben hatte, nach Wien zurückkam und von Maurice
Maeterlinck, der damit, daß er von dem schon einmal genannten
Octave Mirbeau im ‚Figaro‘ mit Shakespeare verglichen wurde, den Gipfel
des Ruhmes für uns unten erklommen zu haben schien, die Kunde
brachte, er sei ein Mystiker, der Bier trinke. Abends im Restaurant
oder überhaupt. Das war viel, das war verblüffend, der Mann
wurde einem zugleich fern und nahe, er war wie wir selbst und dann
eben... Man hatte jedenfalls die beiden Enden des Lebens oder, wie
Heraklit sich ausdrückt, die beiden Enden der Leier in der Hand.
Einige Jahre nach dieser Eröffnung, als der Ruhm des
biertrinkenden Mystikers wohl schon von einigen Schriftstellern in
Paris, aber keineswegs noch in Deutschland bezweifelt zu werden begann,
besuchte ich Maeterlinck, durch einen Brief seinerseits, als Antwort
auf mein erstes Buch, dazu aufgefordert, in Paris in seinem Heim in
Passy oben mit dem Blick auf die Seine, einem
Rokokoschlößchen, von dem ich gerne annahm, daß es ein
großer Herr des 18. Jahrhunderts für seine Geliebte gebaut
hatte. Ich habe niemals später einen Mann der Feder, Dichter,
Mystiker in einer gleich reizvollen, ja beneidenswerten, den Neid
direkt herausfordernden Umgebung gesehen. Ich kam damals zu ihm aus dem
Zimmer eines kleinen Hotels im Quartier latin,
105
in
der Nähe des Panthéon. Mein Zimmer ging auf den Hof und
war, da ich auf Schlüssel keinen Wert legte, später nicht, zu
allen Stunden des Tages und der Nacht jedermann zugänglich. Das
Hotel hieß ebenso simpel wie großartig: de la France, lag rue Touillier 11
und wird von mir hier darum erwähnt, weil Rilke nach mir und, wie
er mir gestand, durch mein Beispiel veranlaßt, nicht nur sich,
sondern auch gleich seinen Doppelgänger Malte
Laurids Brigge darin einquartierte. Ich habe mich sicherlich nicht
einen Augenblick lang im Inneren des Gemütes bei einem Vergleich
der beiden Behausungen aufgehalten, da ich Maeterlincks
Schlößchen betrat, und mich nur betroffen gefühlt, als
dieser von meinem Quartier, das damals noch ganz seinen Charakter
bewahrt hatte und mir unendlich lieb war, nichts anderes zu sagen
wußte, als daß es schmutzig sei.
Maurice Maeterlinck machte mir den Eindruck eines vollkommen
glücklichen Menschen, wenn Glück im Harmonischen eines Ganzen
gesucht werden darf. Er war ein schöner Mann, die Haut des
Gesichtes trocken, sonngebräunt, das Auge blau wie gewisse
altitalienische Fayencen, sein ganzes Wesen und nicht nur der
kräftige, geradegewachsene Körper strömten Wärme
aus, warm war auch seine Stimme, er beklagte sich nur, daß ihm
sein Doktor derentwegen das Rauchen untersagt hätte. Mir fiel das
auf: sein Doktor, mein Doktor. Ich würde mich nur schwer daran
gewöhnen können zu sagen: mein Doktor, mein Schneider und so
weiter. Er erschien mir vorurteilslos — wenn ich von seinem Urteil
über das Quartier latin absah —‚ offen, teilnehmend. Kaum
daß ich bei ihm eingetreten, war er erstaunt über mein
junges Aussehen und meinte, nach meinem Buche habe er einen bejahrten
Philosophen in mir erwartet. Das war
106
vage
und zudem falsch, denn dieses mein erstes Buch sah womöglich noch
jünger aus als ich selber. Daß er ein Mystiker sei oder von
den Leuten dafür gehalten werde, das fiel mir in seiner Gegenwart
nicht ein und nicht auf. Hingegen sagte er mir, daß er gerne
koche und besonders Kartoffeln zuzubereiten wisse wie niemand. Ich
glaube gelesen zu haben, daß er später einem Klub der
Gourmets in Paris angehörte. Es scheint also auch schon damals
nicht mehr gar so bedeutsam oder für ihn und andere wichtig
gewesen zu sein, daß er Bier trinke. Ebensowenig, wie es weiter
noch Sinn gehabt hätte, ihn gerade Mystiker zu nennen. Auf einem
sehr langen Tisch Louis XVI. lag das Pelzcape jener Frau, die damals
das Leben mit ihm teilte, der er seine Bücher widmete und für
die er sein erstes richtiges Theaterstück schrieb, und neben dem
Pelzcape ein Manuskript, daran er eben geschrieben, da ich eintrat. Es
war, wie er mir erklärte, das Manuskript zu La vie des abeilles. Da ist mir,
als ich dieses ein wenig mehr ins Auge faßte, etwas aufgefallen:
daß er daran schrieb, wie ich einen Brief, einen längeren,
schreibe, nicht anders. Er schrieb es einfach hin, seitenweise, so wie
man etwas auf einem Geleise vor sich herschiebt. Das Geleise war da.
Ich sah es vor mir...
Wie kann man nur in einem Geleise schreiben! Man kann in einem Geleise
besitzen, oder man kommt, indem man besitzt, bald und leicht in ein
Geleise und bewegt sich in ihm weiter. Man kann aber in einem Geleise
nicht entbehren. Wodurch ein gewisser, ja nicht nur ein gewisser,
sondern auch ein eminenter Wesensunterschied zwischen Besitzen und
Entbehren entsteht und beides zusammen mehr und anderes bedeutet als
die positive und negative Seite einer Skala. Und man kann, noch einmal,
in einem Geleise nicht schreiben. Man kann
107
und
man darf es nicht. Ich konnte und durfte es nicht. Oder ich hätte
es nur als Seiltänzer können, wenn mir die Natur dazu nicht
von Anfang an den Weg verlegt hätte. Indem ich schrieb, so war
meine Vorstellung, die mich nie verließ, bewegte ich mich, mit
der Feder meinetwegen, in eine andere, in eine neue Dimension, schrieb
ich aus der Welt der Gegebenheiten und Besitztümer, schrieb ich
mich aber auch aus der Welt des Glücks, glücklicher
Gegebenheiten heraus. Nicht flüchtend, sondern darum, weil das
Schreiben nur dann und unter solchen Umständen zu allem anderen
dazu auch einen Sinn bekäme. So wie Maeterlinck hier schrieb,
schreibt man Tautologieen, schreibt man sie gleich in großer
Menge. Ich hatte aber die Vorstellung, mehr als das: die Idee,
daß ich nur schrieb, um aus der Welt der Tautologieen
herauszukommen. Diese Vorstellung und Idee hatte ich zu dieser Zeit,
hatte ich in meiner Jugend in einem sehr hohen Grade. Sie war so stark
in mir, daß ich auch dem Glück, dem Glücklichsein, dem
Besitz auf gewisse Weise die Eigenschaft des Tautologischen zuerkennen
mußte. Später fand ich dann den Begriff und die Idee der
Imagination für alles das, was sich nicht in einem Geleise
vollzieht. Damals aber in meiner Jugend hatte ich sie noch nicht: die
Vorstellung der Imagination.
6
Ich habe ein Frühstück in Erinnerung, das eine Dame aus der
großen Welt in ihrem Palais in der inneren Stadt gab. Es waren
außer nächsten Verwandten nur Dichter geladen. Und ich. Die
Dame des Hauses selbst hatte sich gelegentlich in patriotischen
Stücken versucht, die, glaube ich, an Gedenktagen der Monarchie
das eine oder andere Mal auch aufgeführt worden sind. Eines der-
108
selben,
wurde erzählt, war durch die Anwesenheit des Kaisers ausgezeichnet
worden. Zuweilen stand in einer der leitenden Zeitungen, wohin sie dank
ihrem illustren Namen leichter Eingang gefunden hatte, als ihrem Talent
vielleicht entsprochen hätte, eine Erzählung, darin
Hauslehrer und Kammerjungfrauen Sätze zu sagen hatten, die
für komisch galten oder gelten sollten. Unter den Gästen
befand sich auch der damals berühmteste von Dramatikern der Stadt,
einer von den Führern der jungen Wiener Schule, von dem gerade ein
Napoleonstück seine Erstaufführung in der ‚Burg‘ erlebt
hatte. Das Stück hatte Erfolg gehabt, es erschien mir schlecht,
heute ist mir nur noch, aus einer Äußerung des Helden oder
zum Helden — das weiß ich nicht mehr — hervorgehend, durchaus
sentimentale, auch theatralische, zudem für meinen Geschmack fade
Auffassung von menschlicher Größe als einziges im
Gedächtnis hängen geblieben. Im Gespräch nach Tisch
äußerte nun unser Dramatiker, ohne Zusammenhang mit dem
Stück übrigens, daß er im Leben bisher noch keinem
großen Menschen begegnet sei, wie sehr auch immer er darauf
gepaßt oder sich dazu angestellt hätte. Stets verliere sich
der erste Eindruck, sooft dieser auch anfangs vorhanden gewesen sein
mochte; nach einer Weile sei dann der ‚große‘ Mann, auf den
andere ihn vorzubereiten versucht hätten, kein großer Mann,
sondern nicht viel mehr oder nicht anders als andere Leute auch. Eine
Zeit lang habe er vor Jahren sich der Meinung hingeben wollen, Mitterwurzer,
der sei groß und halte Farbe, oder neben dem käme man nicht
auf und fühle sich von Anfang bis zu Ende klein...
Ähnliche Ansichten sind wohl zu allen Zeiten geäußert
worden. Bezeichnend erschien und erscheint mir noch, und zwar nicht nur
für einen Wiener der neunziger
109
Jahre,
der sich auch das Paradies nicht ohne Theater und das entsprechende
Privatleben von Schauspielern hätte vorstellen wollen, wie der
Schauspieler gleich einbezogen wurde bei der Bemessung der menschlichen
Größe, ein Umstand, der in den Jahrhunderten der
großen Formen unvorstellbar gewesen wäre. Dr. Johnson
würde weder im Wachen noch im Träumen auf den Gedanken
gekommen sein, Garrick
zu den großen Menschen zu zählen oder mit solchen zu
vergleichen. Zu den zwei Jahrzehnten vor dem großen Kriege
gehört nun nicht nur das dazu, daß darin die
allergrößten Schauspieler und Schauspielerinnen vorkamen:
Mitterwurzer, die Duse,
die Wolter,
die Sada
Yakko, wobei ich eine ganze Schar der außerordentlichsten
auslasse: Kainz, Matkowsky, Sonnenthal, Girardi, Else Lehmann,
Baumeister, Robert, sondern eben noch das, daß der Mensch des
wirklichen und der des scheinhaften Lebens mit demselben Maß
gemessen wurden oder daß, wenn einer große Menschen nannte,
Schauspieler darunter vorkommen durften.
Das war nun Individualismus, oder das bestimmt den Individualismus
wesentlich. Und das war noch etwas: gegen den Geist der Kirchen,
Orthodoxieen und Dogmen welcher Art immer
und damit in Verbindung gegen den Geist der großen Formen. Die
alle zusammen, Kirche und große Form, das Streben aufweisen, die
Individualität innerhalb einer, innerhalb ihrer Ordnung zu
fixieren. Der Individualismus jener Zeit nun, zu welcher meine
Erinnerung mich zurückführt, hatte es weder verstanden noch
auch gewollt, die Individualität zu fixieren.
Angeregt durch den häufigen Besuch des Burgtheaters in meinen
Wiener Studentenjahren und später des Deutschen Theaters in
Berlin, das mit Recht damals als die
110
zweite
deutsche Bühne gelten konnte, aufmerksam gemacht durch die
Wichtigkeit des Schauspielers im sozialen und geistigen Leben der
beiden Städte, vornehmlich Wiens, bin ich sehr bald dazugekommen,
mir Gedanken zu machen über die Beziehung der Persönlichkeit
zum Schauspieler, allgemeiner: über die Beziehung zwischen dem,
der etwas ist, und dem, der es scheint oder spielt.
Viele werden mich hier nicht begreifen, indem sie meinen, mittels einer
vernünftigen Auffassung von den Dingen, worauf sie ein Recht
hätten, den möglichen Gegensatz, der in dieser angedeuteten
Beziehung liege, aus der Welt zu schaffen oder zum mindesten zu
ignorieren. Denen sei hiermit die folgende Generalerklärung
abgegeben, daß mir die Welt stets oder doch zunächst als
eine der Formen und Gestaltungen aufgefallen sei und so mein
höchstes, unaufhörliches Staunen erregt habe und nicht als
eine in ihren Ursprüngen und Zielen vernünftige oder in den
Einrichtungen und Anordnungen ganz und gar vernunftgemäße.
Vom Vernunftgemäßen her braucht es uns freilich nicht
wunderzunehmen, daß eine große Persönlichkeit des
wirklichen Lebens und eine der Bühne nebeneinander bestehen, ohne
einander zu genieren, aber die Welt ist nicht ohne weiteres
vernünftig oder mittels Vernunftschlüssen aufzudecken. Wenn
sie es wäre, würde ich, um ein allernächstes Beispiel
anzuführen, keine Zeile im Leben niedergeschrieben und das
Ungeformte damit zu formen versucht haben.
Was in den neunziger Jahren und früher als Mystik, Mystizismus
gelten wollte und unter gewissen Kautelen gelten konnte, das bestand
aus einigen noch sehr vagen Vorstellungen von der genannten Tatsache.
Das muß noch eingeschoben und diesem soll noch das folgende an-
111
gefügt
werden: In jener Anschauung der jungen Wiener Dichterschule, die damals
das Interesse der um solche Dinge im Geiste Bekümmerten auf sich
gezogen hatte, daß wir nämlich selber die Schauspieler
unseres Lebens seien, habe ich unter allen Umständen nur den
Ausdruck einer falschen, einer scheinbaren Tiefe und einer
trügerischen Vernunft erblicken können, im besonderen Sinne
auch kaum mehr als eine jener Tautologieen, wie solche meine Jugend
gestört haben, und es ist mir gelungen, zugleich mit der Ablehnung
der genannten Anschauung mir jene Idee der ‚Umkehr‘ anzueignen, die
letztlich den ‚Inhalt‘ meiner frühen Gleichnisse bildet, welche
unter dem Titel Der Tod und die Maske
vereinigt sind.
Nachdem ich die zwei kurzen Bemerkungen eingeschoben habe, setze ich
fort: die Gedanken also, die ich mir über die Beziehung zwischen
dem, der etwas ist, und dem, der es spielt, machte, waren im Grunde
dieselben wie jene, die den jungen Rousseau beschäftigten, als er
seine berühmte Abhandlung über den Einfluß des Theaters
auf die Sitten und den Charakter des Menschen niederschrieb.
Nur besteht der folgende Unterschied zwischen ihm und mir: Rousseau,
der Kalvinist, hatte den Mann der Tugend vor Augen und forderte dessen
Schutz, ich aber hatte der zugleich geheimnisvolleren und durch
Abstammung, Umgebung begrenzteren Persönlichkeit zu gedenken.
Rousseau war Moralist mit dem Ziel einer für die ganze Menschheit
gültigen Tugendlehre, ich grub, auch hier von der Form ausgehend,
unter der Tugend mir einen Raum aus, darin eben jenes Metaphysische,
Wenn es so gesagt werden darf, aufgespeichert liegt, in welches die
Persönlichkeit ihre Wurzeln senkt. Rousseaus Einstellung kam von
jener der ganzen antiken
112
Welt
bis zu Augustinus eigentümlichen, gemäß welcher oder
aus welcher her das Originale und die Nachahmung zwei voneinander
getrennte Sphären bilden, und war nur innerhalb einer Welt der
großen Formen zu halten gewesen. Der Individualismus hat nun die
beiden Sphären der Natur und der Nachahmung durcheinander
geworfen, woraus unmittelbar die Gefahr entstehen mußte,
daß die Persönlichkeit zum Schauspieler werde, wofür es
in den Jahrzehnten vor dem Krieg sehr hervorragende Beispiele gegeben
hat, und der Schauspieler wiederum als die zugleich eindringlichste,
plausibelste und auch ehrlichste Persönlichkeit übrig bleibe.
7
Ich habe das europäische Theater von 1892 an in allen
Hauptstädten erlebt, war wiederholt auch Zeuge so im Stil und
Geist vollkommener Aufführungen wie jener Molières im
Théâtre français oder im Théâtre des
Variétés mit der sublimen Lavallière,
die sicherlich durch ihre spätere Konversion zu den ergreifendsten
Frauengestalten der Jahrhunderte gehört, ich saß in Moskau
im Parkett, da Tolstois Lebender
Leichnam in Gegenwart der Hinterbliebenen des Dichters als eine
Art Totenfeier von der Truppe Stanislawskis
zum ersten Male aufgeführt wurde, darin selbst das durch alle
anderen Darstellungen des Moskauer Künstlertheaters festgelegte
Niveau überschritten wurde und neben welcher mir die deutschen
Aufführungen mit ihrer vielgerühmten Darstellung des Helden
nur schwer erträglich erschienen. Das größte
Theatererlebnis aber waren mir jene beiden Schauspieler, die ich
für die größten meiner Zeit, dreist gesprochen,
für die größten aller Zeiten halte: Friedrich
Mitterwurzer und Eleonora Duse.
113
Ich
habe sie in allen ihren Rollen gesehen und will jetzt von ihnen in
einer Weise reden, welche dem gegenwärtigen Geschlecht vielleicht
übertrieben, auf alle Fälle befremdend erscheinen muß,
die ich aber trotzdem vor dem Geist der gesamten Kunst, wenn ich mir
einen solchen jetzt vorstellen darf, zu verantworten imstande bin.
Beide, der Deutsche und die Italienerin, konnten nur in einer Epoche
zur Geltung kommen und ihre Kunst auf den denkbar höchsten Gipfel
bringen, da Persönlichkeit und Schauspieler sich gegenseitig auf
die eben bedachte Art herausforderten. Bisher war der Schauspieler von
der Persönlichkeit und umgekehrt diese von jenem durch die
gesellschaftliche Ordnung, durch eine das ganze Menschenwesen
erfassende Orthodoxie der Sitte getrennt, hier und jetzt aber schlugen
beide zusammen, einander durchdringend, und zwar dank der einzigen
Genialität der beiden Künstler, dank aber auch dem neuen
Sinn, welcher durch sie ihrer Kunst verliehen wurde. Dazu war es in der
Tat gekommen, zu dem neuen Sinn, wobei Sinn nichts anderes ist oder
sein kann als die vollkommene Auflösung jener zwei Antinomieen des
Wirklichen und des Scheins. Solange oder soweit nämlich zwischen
den beiden Reichen oder Sphären oder Antinomieen des Wirklichen
und des Scheins noch so etwas wie Ordnung, Kaste, Sitte und Orthodoxie
dazwischenlag, konnte es nicht zu einer so reinen Sinnbildung kommen.
Etwas mußte erst ins Wanken kommen, etwas sich seinem Ende
nähern. Und in den neunziger Jahren mit ihrer uns heute sagenhaft
erscheinenden Sekurität war etwas ins Wanken gekommen und war
zugleich etwas in Bildung begriffen, doch so, daß
Erschütterung und Neugestaltung einander noch störten.
Störten und trübten im Gebiete der
114
ganzen
übrigen Kunst, der Dichtung, der Malerei, der Skulptur. Und
daneben mußte und durfte mir die Kunst dieser beiden einzigen
Mimen als etwas viel Reineres, Schlackenloseres erscheinen, als etwas
Vollkommenes und darum Göttliches, weil wir das schlechthin
Vollkommene aus unserem Menschentum heraus nicht auf sich beruhen
lassen dürfen und dem Göttlichen gleichsetzen müssen,
welches Göttliche dann allein in der endgültigen Einigung, in
der Ureinheit von Sein und Sinn erblickt werden darf.
Mitterwurzer pflegte zu sagen, er sei mit seiner ganzen Kunst, die
ungefähr alle großen Rollen des europäischen Theaters,
die tragischen ebensogut wie die komischen, umfaßte, nichts
anderes und nicht mehr als solche Gaukler, Feuer- und Schwertschlucker,
wie man sie noch in den neunziger Jahren in den Straßen Londons
abends bei Fackelbeleuchtung ihre Künste produzieren sehen konnte,
und nichts daneben oder darüber: kein Bürger, kein Gentleman,
Hofrat, Staatsrat und weiß Gott was sonst noch. Er wollte zum
Ursinn der Schauspielkunst durchdringen, und dank seinem Genie gelang
ihm mehr: zum Ursinn der dramatischen Kunst durchzudringen, will sagen:
zu den Verwandlungen des Dämons.
Ich gedenke seines Franz Moor in den Räubern. In der letzten
Szene begann Mitterwurzer plötzlich zu tanzen, in roten
Stöckelschuhen zu tanzen, rasend schnell, so daß es aussah,
als dränge rotes Feuer aus den Sohlen und mengte sich mit dem
Feuer, das aus dem Zimmerboden des brennenden Schlosses und aus den
Wänden und Mauern zu lecken anfing. Franz Moor war nicht mehr der
von Höllenangst gejagte böse Mensch, sondern der Teufel, der
Dämon selber, er war es ganz und gar, bis zu den Fußsohlen
herab, daraus das Höllenfeuer
115
spitzte,
Franz Moor hatte aufgehört als Person zu existieren, und wir im
Parkett oder auf der Galerie waren nicht mehr Zuschauer, sondern
Mitglieder einer Kultgemeinschaft, welche der Verwandlung eines
Dämons, dessen Gaukelei beiwohnt.
Die Verwandlung hätte nicht vor sich gehen können, wenn
irgendwie ein Beiläufiges, eine Spur davon, vorhanden gewesen oder
übrig geblieben wäre. Das Beiläufige, auch das, was in
der Idee von der Bohème liegt oder damit zusammengeht, hat
gefehlt, fehlt im Leben und Werk des Genies. Man könnte das
Geniale damit definieren: Fehlen alles Beiläufigen, aller
Beiläufigkeit.
Damit im Zusammenhang steht dann auf wunderbare Weise das Paradox, die
Ironie im Leben des genialen Menschen, welches Paradox und welche
Ironie innerhalb einer Welt von Beiläufigkeiten gar nicht
hätte aufkommen können. In seiner Todesstunde ist es
Mitterwurzer wie durch einen Gnadenakt des Schicksals gelungen, den
Sinn seines ganzen Lebens: die Anonymität des Dämonischen,
aufzufangen und preiszugeben. Er hatte drei Wohnungen: bei seiner Frau,
bei seiner Geliebten und in einem Zimmer des Residenzhotels in der
Nähe des Burgtheaters. Dort erkrankte er eines Tages und
mußte das Bett hüten. Nachts spürt er Durst und greift
statt des Wasserglases die Medizinflasche und trinkt sie aus. Zwischen
dem am Gift Sterbenden und dem herbeigeholten Hotelarzt findet das
folgende kurze Gespräch statt: Wie heißen Sie? Mitterwurzer.
Was sind Sie? Schauspieler. Wo? Am Burgtheater. Worauf der Tod erfolgte.
Indem Mitterwurzer zum Ursinn seiner Kunst strebt und ihn, nichts
ahnend, trifft, ging er nicht von irgendeiner Idee aus, vom Pathos des
Allgemein-Menschlichen, son-
116
dern
direkt vom Männlichen, von der zeugenden Kraft desselben, vom
Geschlecht. Woraus sich dann ergeben mußte, daß er sich in
den anderen verwandelte, und zwar restlos: verwandelte als
Eindringender, daß es für seine Kunst keinen anderen Weg gab
als diesen: den männlichen der Verwandlung. Während die Duse
das Andere in sich, das Theater in ihr Leben, in ihre eigene ungeheure
Lebendigkeit verwandelte. Mitterwurzer brachte das ganze Leben auf die
Bühne; wohin er trat, war Bühne, Brett, Sprungbrett, der
Teppich darauf. Nur Gott war für ihn nicht auf der Bühne.
Wenn er, wie das täglich vorkam, in einer der Kirchen Wiens auf
den Altarstufen kniete, so war das dann nicht mehr Bühne. Auch
indem er fest an ein Wiedersehen mit seinem verstorbenen
Töchterchen glaubte, hatte er sich der Bühne, allem
Bühnenhaften entzogen.
Die Duse war nicht fromm, sie spielte nicht, sondern sie lebte auf der
Bühne, als ob diese der einzige Raum wäre, worauf sie, in
welchen Rollen immer, ihr wahres Leben leben könnte. Und wenn in
ihr Frömmigkeit war, so konnte diese in gar nichts anderem zum
Ausdruck kommen als im wahren Leben einer Rolle. Wo anders hätte
sie fromm sein können? In ihrem Leben fehlte dementsprechend ganz
und gar das Paradox, die Ironie. Oder war das ihr Paradox, daß
sie außerhalb ihres Raumes, fern vom Volk, in der fremdesten
Fremde, weit, weit weg in einer grauslichen, rauchigen Stadt Amerikas
starb? Oder daß sie die Schauspielerei haßte? Oder
daß sie einmal zu einer gemeinsamen Freundin ungefähr so
redete: Theater ist Unsinn, alles im Leben ist coucher avec quelqu’un qui vous aime et
que vous aimez.
Auch in ihrer Kunst fehlte alles Beiläufige oder war durch sie das
Beiläufige für alle Ewigkeit getilgt. Und so allein
117
konnte
es auch hier zum Verwandlung kommen, zum Mythos, zur Aufhebung des
Gegensatzes.
Ich gedenke ihres Spiels in L’altro
pericolo, einem französischen Boulevardstück. Darin
gab es eine Szene, vor welcher das Publikum aufhörte, Publikum zu
sein, sondern einen einzigen Körper bildete, indem
buchstäblich jeder dem, der ihm zunächst saß,
körperlich näher zu kommen suchte, indem er an ihn
heranrückte: um des einen ringförmig-riesigen Körpers
willen, zu welchem die eine übermäßige, riesige
Empfindung die Menschen jetzt zu schmieden schien. Die Szene ist an
sich sehr banal: Die Tochter beginnt zu ahnen, daß ihr
Bräutigam der Geliebte der Mutter gewesen sei. Ihre erschrockenen,
forschenden Blicke wollen sich zur entscheidenden Frage verdichten. Die
Mutter, von der Duse gespielt, will die Frage zurückdrängen,
ersticken und schreit, indem sie sich mit ihrem Leib auf die Tochter
stürzt, diese mit sich selber und mit der Hand den Mund zudeckend:
No, no, no, no.
Das war alles, und das war der größte Schrei, der im Leben
je an mein Ohr gedrungen ist; es war die Flamme eines Schreis, was da
ausbrach. Und so kam Flamme zu Flamme, Feuer zu Feuer, denn auch das,
was aus der Tochter aufzüngelte, Frage, Zweifel, Haß, war
Flamme, war wie ein Feuer, plötzlich sich entzündend, das ein
Mensch damit löschen will, daß er sich darauf mit seinem
ganzen Körper legt. So kam Flamme zu Flamme, Seele zu Seele, der
Gegensatz war aufgehoben.
8
Ich hatte also damals in Mitte der neunziger Jahre nicht nur das
Glück, im selben Jahr und in derselben Stadt den Mitterwurzer und
die Duse spielen zu sehen, die sich, um
118
das
noch zu sagen, so wundervoll in ihrer Art ergänzten, wie sich in
indischen Mythen göttliche Wesenheiten oder Prinzipien vom
Geschlechtlichen her ergänzen oder wie in den über ganz
Indien verstreuten Lingamfiguren das Männliche und Weibliche
ineinandergefügt sind, sondern es war mir auch die Gelegenheit
geboten, die zwei größten Schauspielerinnen: die Wolter und
die Duse, die oft am selben Abend jede in ihrem Theater in Wien
spielten, und damit zugleich die zwei Stile der Schauspielkunst zu
vergleichen: den idealistischen und den realistischen, welche gerade
damals einander ablösten.
In Wien wurde unter den Theaterkundigen der Gesellschaft und der Kritik
das Stilproblem damit aufgeworfen, daß die Frage ein wenig zu
naiv so gestellt wurde, wer größer sei: die Wolter oder die
Duse. Daß die Antwort verschieden, und zwar von Seiten der
Älteren zugunsten der Wolter, von seiten der Jüngeren
zugunsten der Duse, ausfallen mußte, ist nur zu begreiflich. Ich
möchte nach so vielen Jahren nun meine Antwort so geben, daß
damit auch ein Prinzipielles jeglicher Kunst hervorgekehrt wird.
Für das Spiel der Wolter war es wesentlich, daß es erstens
einem Gesamtkörper eingefügt war, darin sie selber immer nur
als Erste unter Gleichen, als Chorführerin im besten Falle, gelten
konnte, und daß zweitens in jener Welt, die sich in ihrem Theater
spiegeln sollte, Ordnung und Rang gegeben waren, und zwar genau
dieselbe Ordnung, welche in der Wolter selber die Schauspielerin von
der gesellschaftlichen Persönlichkeit: Bürgerin, Gattin,
Geliebte, zu trennen berufen war. Die Wolter war die größte
Tragödin in der Ära des Liberalismus, welcher als
Übergang vom Idealismus zum Realismus gelten kann und muß.
Die Idee und Einzigkeit ihrer Darstellung lag
119
nun
darin, daß sie die Welt des Maßes, von welcher sie ausging,
am Gipfel oder am Ende mit einem ihr allein eigenen Realistischen, mit
dem berühmten Schrei, aufriß. Dieser ihr Schrei war
Todesschrei, der Schrei der Duse hingegen war nicht Todes-, sondern
Lebensschrei, der Schrei einer neuen Geburt, der Schrei der Geburt in
eine neue seelisch-geistige Welt. Ich kann die Welten der beiden
Künstlerinnen nicht besser charakterisieren als damit, und es
bedeutete schon etwas, daß diese beiden Schreie an das Ohr und in
die Seele eines sehr jungen und völlig unversierten Menschen
dringen konnten und von ihm vernommen wurden.
Versteht man mich, wenn ich sage, daß die Wolter wesentlich
Tragödin, die Duse einfach Schauspielerin war? Schauspielerin, die
das Leben an sich riß. Die mit ihrer Kunst das Leben auftrank,
aufhob. So daß am Schlusse gar nicht mehr zu entscheiden war, wo
Kunst anfange, Leben aufhöre, Kunst aufhöre und Leben
anfange. Die Wolter mußte aus diesem Grunde mit der Rolle, mit
dem Wert des ganzen Stückes wachsen. Die Duse hingegen war in den
schlechtesten Stücken am besten und versagte nur einmal ganz: als
Kleopatra in Shakespeares Tragödie. Shakespeare gibt unter allen
Bedingungen eine Welt mit unverstellbaren, unverrückbaren
Maßen. Es ist ganz töricht, ihn maßlos zu nennen. Er
ist es ebensowenig, wie die Natur oder die Welt der Gestirne
maßlos sind. Maßlosigkeit liegt nur dort vor, wo Kunst und
Leben sich aneinander verbrauchen. Und Maß kann aus dieser
Maßlosigkeit nur durch eine neue Geburt, aus einer solchen
gewonnen werden.
Es gab damals allerhand Stile innerhalb der Schauspielkunst: den
Verismus der meisten italienischen Virtuosen Wie Novelli oder Zacconi, den
puren Naturalismus, der
120
in
Berlin gepflegt wurde, aber wie jeder Naturalismus an seiner Armut
zugrunde ging, und dann eben den Realismus der Duse, der über sich
hinausführte in einen neuen Mythos, und zwar in den der Seele
selber. Hier erweist die Duse ihre Verwandtschaft mit den großen
Russen wie Gogol, Dostojewski und Tolstoi. Von diesem neuen Mythos, von
Mythos überhaupt, war im Spiel der Wolter nichts, denn darin
wurden und blieben die Götter- und die Menschenwelt durch das
Pathos geschieden. Und ebensowenig wie die Duse je hätte die Verse
des Anfangsmonologs der Iphigenie sprechen können, so daß
der Zuhörende zum ersten Mal fühlt und begreift, was und
warum Verse seien, würde die Wolter die Sätze der Gioconda
des d’Annunzio im letzten Akt so haben sagen können, daß
Rhetorik zur Dichtkunst erhoben und die Metapher, das Bild als die
gegebene Sprache der sich ewig aus sich selbst erneuernden Seele
erschien.
Es ist viel über die Bedeutung des Wiener Theaters für Wien
selbst und für das alte Österreich geschrieben worden. Es
kann nicht geleugnet werden, daß im allgemeinen eine gewisse
Beziehung zwischen dem Talent und der Liebe zum Theater und dem Talent
oder der Unbegabung zur Politik besteht. Möglicherweise gehen
Theater und Politik bei den Italienern und Franzosen besser zusammen
als bei den nordischen Völkern. Das England des
spätviktorianischen Zeitalters hatte außerordentliche
Politiker und dilettantenhafte Schauspieler gezeitigt, unter letzteren
den unleidlichen Virtuosen Henri Irving,
dessen Shylock von den vielen, die ich gesehen, der schlechteste war.
Nach dem Weltkrieg scheint sich hier das Verhältnis zugunsten der
Schauspieler ein wenig verschoben zu haben. So wie das Wiener Theater
in meiner Jugend nun einmal war, sind davon der Katholizismus,
121
der
Hof, die Gesellschaft nicht wegzudenken und mußte es einer
Generation wie jener nach dem Weltkrieg fremd werden. In der herrlichen
Fidelio-Aufführung zum hundertsten Todestage Beethovens unter Franz Schalk mit
Lotte Lehmann
in der Titelrolle sehe ich den letzten Versuch, an die große
Tradition des Wiener Theaters anzuknüpfen.
Die Jugend von heute steht dem Individualismus mit dessen Kult des
Schauspiels und der Schauspieler fremd, wenn nicht feindlich
gegenüber. An Stelle des Individualismus mit seinen
Erziehungsmöglichkeiten und Erziehungswilligkeiten durch das
Theater ist das Verhältnis des einzelnen zum Kollektiv, des
Führers zur Volksgemeinschaft getreten. Da ich hier meine
Erinnerungen an lang Vergangenes niederschreibe, habe ich auf dieses
Verhältnis nicht einzugehen. Nur eines soll bemerkt werden: Im
Moskauer Künstlertheater war schon vor dem Weltkrieg eine Spur von
dem Kollektivismus einer kommenden Zeit zu verfolgen. Ich habe
Tschechows Onkel Wanja, auch
um mein Ohr an das Russische mehr und mehr zu gewöhnen, wenn ich
nicht irre, fünfmal hintereinander oder in den allerkürzesten
Pausen gesehen und wahrnehmen können, daß jede
Aufführung an sich vollkommen und eine der anderen gleich, ja mit
ihr bis ins Allerkleinste hinein identisch war. Ohne mich hier
über das Prinzipielle einer solchen Behandlung von Stück und
Schauspieler entscheiden zu wollen, möchte ich doch auch darin den
Grund dafür sehen, warum im Rußland von heute nach der
Aussage aller, die von dort kommen, das Theater allein von allen
öffentlichen und privaten Unternehmungen seinen Rang behauptet hat.
Man könnte von da aus, von der Stellung des Schauspielers
innerhalb des Kollektivismus, eine neue Staats-
122
lehre
schreiben, die sich in manchem als das Gegenstück zu jener
platonischen erweisen müßte, welche, roh gesprochen, davon
ausgeht, daß Dichter und Schauspieler lügen. Wer lügt
nun und wer lügt nicht innerhalb eines puren Kollektivums? Ist der
Schauspieler darin überhaupt noch Schauspieler im Sinn eines
nachahmenden Wesens? Und ist hier nicht vielmehr jede mögliche
Originalität welcher Art immer vom Schauspieler untrennbar? Das
Theater Meyerholds,
das ich nach dem Kriege in Paris gesehen habe, basiert irgendwie auf
dem genannten Vollkommenheitsprinzip Stanislawskis. Der Schauspieler
spielt im kommunistischen Theater nicht mehr das Dichtwerk, sondern er
spielt mit demselben. Er stellt sich über den Dichter. Die Welt
mündet in ihn oder endet darin. Der Schauspieler darf darum die
Spitze einer Pyramide ohne Basis genannt werden.
9
Hatte der Individualist der neunziger Jahre Lehrer? Oder hatte er nicht
am Anfang der Lehrzeit wenigstens gerne und leicht die falschen? So
daß er meist nur auf Umwegen zum Richtigen und Anerkennenswerten
gelangen konnte. Die Idee einer Disziplin war durch den Liberalismus
sehr verblaßt, der Individualist stand ihr in gewissem Sinne
direkt feindlich gegenüber. Ich habe aus den ‚falschen‘
Büchern sicherlich mehr gelernt als aus den ‚richtigen‘. Alle
Orthodoxie beruht zuletzt darauf, daß es Verführung nur zum
Schlechten oder Falschen gebe. So ein Individualist aber hatte
irgendwie das Gefühl, daß es Verführung auch zum Guten
geben dürfe und müsse.
An der Wiener Universität fehlte ich durch zwei Jahre hindurch in
keiner Vorlesung von Alfred
Freiherrn von Berger, einem geistreichen Mann und ganz
außerordent-
123
lichen
Redner, der alles auf das Theater bezog, für den die ganze Welt um
des Theaters willen geschaffen schien. Ich bin nur einmal aus seinem
Kolleg ausgeblieben, als dieses Leonardo da Vincis Traktat von der
Malerei behandelte. Hier war der Theatermann nur deplorabel, denn bei
Leonardo kann durchaus nichts auf das Theater bezogen werden. Berger
war sehr geistreich oder was man damals gerne so nannte, offenbar aber
genügt das Geistreiche allein nicht, um endgültig einzusehen,
daß von allen großen Künstlern der Erde in Leonardo da
Vinci am wenigsten Theater ist. Hingegen hat Berger als geistreicher
Mann eines verstanden, was mir das ganze Leben lang versagt blieb: um
ein einziges Aperçu herum oder, wenn man es so vorzieht:
darüber oder darunter eine ganze Vorlesung von dreiviertel Stunde
anzulegen. Ich habe das damals sehr bewundert, wohl wissend, daß
ich die Fähigkeit dazu nie erlangen würde. Zuweilen war wohl
das geistreiche Aperçu nicht mehr als das folgende in einer
Vorlesung über Shakespeares Sommernachtstraum: daß uns
allen, so wie wir nun einmal sind, sitzen oder stehen, Puck den Saft
der Blume Love in Idleness,
‚Liebe im Müßiggang‘, in die Augen träufle, damit jeder
von uns sich dann gleich Titanien in ein Monstrum mit einem Eselskopf
verliebe. Vielleicht erscheint dieses Aperçu heute manchen nicht
mehr allzu geistreich, und das müßte hingenommen werden. Wie
wurde es aber am Schluß der Vorlesung, diese vorzeitig
beendigend, gebracht! Mit einem Lächeln, das in einem
stimmreichen, mit einem mannigfaltigen Kehlhals versehenen Schlund auf
und ab zu fahren und den Kehlhals oder Kehlbraten ausgiebig zu
schütteln hatte, mit einem Auge, das nur mehr noch im allgemeinen
verweilen wollte, nicht ohne Selbstgefälligkeit ein ebenso
entzücktes wie überzeugtes Audi-
124
torium
rasch überblickend, und mit einer Gebärde der nach der
Saaldecke zu geöffneten linken Hand, die in die Gegend des Magens
postiert wurde und folgendes ausdrücken sollte: Was ich da
behaupte, ist abgewogen und ein für allemal so sichergestellt,
daß wir es ruhig mit nach Hause nehmen und dort pflegen
dürfen. Und ist zudem eine Wahrheit, derentwegen ein Mensch sich
nicht erst zerreißen muß, sondern bleibt, was er ist. Das
sollte sie ausdrücken, die Gebärde der linken Hand, in der
Gegend des Magens postiert, nach oben geöffnet.
Die neunzigerjahre bedeuten neben manchem anderen — den letzten Jahren
der Herrschaft des Pferdes vor dem Motor etwa — den sehr
allmählichen Übergang von der streng wissenschaftlichen,
naturwissenschaftlichen, kausalen Methode zu einer
geistesgeschichtlichen Konzeption der Dinge. Als Gerhart Hauptmann
wieder einmal einen der damals zu vergebenden Dichter- oder
Dramatikerpreise oder auch denselben zum zweiten Male erhielt und
dementsprechend gefeiert wurde, begrüßte ihn einer der
Leuchten der Wiener Universität, der große Geologe E. Sueß,
erinnere ich mich, mit einer Rede, darin er zu eigener Befriedigung,
wohl auch zur Zufriedenheit des Gefeierten darzulegen versuchte, wie
beide, der Dichter und der Mann der Wissenschaft, mit demselben
Instrument, will sagen: mit der kausalen Methode, jeder in seinen
Gegenstand einzudringen suchen, diesen bloßlegend, der Geologe
Erdschichten, der Dichter den Fuhrmann Henschel oder das Rautendelein.
Eine solche Auffassung vom Dichterischen, uns heute grotesk anmutend,
war damals möglich, als man noch von einer Versöhnung von
Glauben und Wissen durch irgendein Mittleres, Akzeptables oder von
einer Eroberung der Glaubensgebiete
125
durch
das Wissen redete und der Pfarrer
von Kirchfeld als tragisch empfunden wurde.
Ich hatte allerhand Kollegs belegt, geschichtliche, sprach- und
literaturwissenschaftliche, auch, wie erwähnt, ästhetische.
In meinem Inskriptionsbuch finde ich ein einstündiges über Byrons Kain, das ein Dozent der
Philosophie hielt. Es muß darin wohl auch um das Thema Glauben
und Wissen gegangen sein. Die neunziger Jahre sind dadurch
gekennzeichnet, daß man in ihnen zum letzten Mal Inhalt und Form
einer Dichtung zu trennen und die Dichtung als Substrat eines
Gedankengebäudes hinzunehmen wagte, was alles auf die große
Antinomie des Liberalismus: Glauben und Wissen betreffend,
zurückgeführt werden darf. Ich muß das Geständnis
ablegen, daß ich niemals ein philosophisches Kolleg zu Ende
gehört oder ein Lehrbuch der Psychologie in der Hand gehabt habe.
Was neben offenbaren Nachteilen den einen Vorteil hatte, daß ich
eine ganz primitive Stellung zu allen Fragen der Philosophie lange
bewahren durfte, daß ferner so einfache Angelegenheiten derselben
wie etwa der Satz des Widerspruchs von mir und für mich entdeckt
oder gar erfunden werden mußten. Die Sprache in Zahl und Gesicht kann nur verstehen
und einsehen, wer fühlt, daß Philosophie für mich
ebenso ein Geisteserlebnis wurde und nach meiner Anlage werden
mußte wie für die griechischen Philosophen des 6.
Jahrhunderts vor Christus.
Ich habe, um darauf noch einmal zu kommen, zu keiner Zeit unter dem
Konflikt von Glauben und Wissen gelitten, ja diesen auch nur
nachzufühlen vermocht. Irgend etwas in Byrons Kain oder in Renans Das Leben Jesu schien mir nur
aufgeschwollen und mit Nichts, mit Leerem angefüllt. Die Zeit war
dafür schon vorbei. Aber
126
gerade
darum, weil ich die Konflikte und Scheinlösungen eines Renan nicht
mehr empfinden und hinnehmen mochte, mußte es mir in der
Philosophie einzig und allein darauf ankommen, das Primitive oder
Leidenschaftliche mit dem Geistigen zu vereinigen, damit ein Ganzes und
ein Lebendiges da sei. Ich habe zu allen Zeiten die banale
Gegensätzlichkeit von Sinnlichkeit und Geist, wie sie von der
Jungdeutschen Schule, die Antinomie: Griechentum und Christentum, wie
sie von Heinrich
Heine affichiert wurde, unverbindlich, unleidlich gefunden, darin
durchaus ein Ergebnis eines flachen Denkens und Empfindens gesehen und
darum auch gehaßt. Je sinnlicher, um so geistiger — so schien es
mir richtig. Und zwar schon zu einer Zeit, da ich noch lange nicht
wußte, daß das Wesentliche einer solchen Spannung zwischen
Sinnlichkeit und Geistigkeit eben jene Einbildungskraft ausmache, ohne
welche Sinnen- und Geisteswelt auseinanderfallen müßten oder
niemals zusammengekommen wären.
Aus der eminenten Bedeutung, welche die Idee der Einbildungskraft
für mich und jenes Weltbild erlangte, das sich in mir formen
sollte im Laufe eines Menschenalters, ergibt sich zweierlei: Erstens,
daß ich, noch einmal, nie unter der sogenannten
Unversöhnlichkeit von Glauben und Wissen zu leiden hatte, und
zweitens, daß mich das Ideal vieler junger Leute aus meiner
Jugendzeit, das Ideal: zugleich tiefsinnig und, um einen Nestroyschen
Ausdruck zu gebrauchen, ein verfluchter Kerl zu sein, nicht zu
kaptivieren oder auch nur zu beunruhigen vermocht hat, da ich wohl
fühlte, daß es auch hier auf wahre Einbildungskraft ankommen
müsse, wenn der Tiefsinn und der ‚verfluchte Kerl‘ nicht
alsogleich auseinanderfliegen sollen, daß also in keinem Fall mit
Summierungen
127
etwas
erreicht würde. Sollte doch mit meiner Idee von der
Einbildungskraft schließlich nicht mehr, aber auch nicht weniger
behauptet werden, als daß Summierungen nicht gelten oder man mit
ihnen nicht weiter- oder aus den Kulissen des Lebens herauskomme.
Die Methode jener Wissenschaft, darin ich meine Doktorprüfung
gemacht und das Doktorat der Philosophie freilich bloß mit
Mehrstimmigkeit erlangt habe, war wie alle anderen, die streng
wissenschaftlich gehandhabt werden sollten, die kausal-genetische,
welche im speziellen Falle etwa in solchen Fragen zusammengefaßt
werden konnte: Woher hat der Autor, Goethe oder sonst einer, den Stoff?
Wie wurde derselbe Stoff von anderen Autoren welcher
Größenklasse immer, auch von ganz minimen, behandelt? Woher
kam der Stoff überhaupt? Welcher Einfluß liegt bei diesem
oder jenem Werk vor, wenn wir endlich vom Stoff absehen? Gibt es noch
etwas anderes auf der Welt als Stoff und Einfluß? Welche Frau
also hat Goethe am meisten geliebt, und von welcher wurde er am meisten
geliebt? Hat er es selber noch genau gewußt, als er sich
darüber nach Verlauf einer geraumen Zeit zu anderen mündlich
oder schriftlich äußerte? Oder können wir erst so etwas
ganz richtig wissen und uns dabei beruhigen?
Das Fazit einer ausgiebigen Behandlung von Stoff und Einfluß
waren dann langwierige Inhaltsangaben von solchen Romanen und Dramen
aus allen Jahrhunderten, die ein Mensch nur zur Strafe für
allerlei Begehungs- oder Unterlassungssünden zu Ende lesen
könnte. So mußte ich in einem Kolleg über das Drama des
19. Jahrhunderts Inhaltsangaben der meisten Stücke von Kotzebue
oder doch sehr vieler davon mitschreiben oder anhören. Die
wichtigste von allen Fragen aber war die
128
nach
dem Einfluß. Es sah manchmal so aus, als ob der Einfluß
dazu bestimmt wäre, jede Inspiration niederzuhalten gleich von
Anfang an, oder als ob es ohne Einfluß zu gar nichts hätte
kommen können auf Erden oder wir samt dem Professor, wenn es
diesen Einfluß nicht gäbe, nicht erst ins Kolleg zu gehen
brauchten und jeder hübsch zu Hause bleiben könnte, was
meinerseits freilich oft genug auch geschah.
Was gänzlich fehlte in den Auseinandersetzungen der Professoren,
war die Idee der Form, war das Formsehen, die Einsicht, daß Form
vor Einfluß gehe und die Welt nicht des Einflusses, sondern der
Form wegen geschaffen wurde, daß Form und Art in verschiedenen
Reihen korrespondieren. Noch behauptete der Darwinismus die Herrschaft
über die Köpfe der Gelehrten und Laien, und das Forschen nach
Einflüssen war letztlich nichts anderes als Darwinismus, auf das
Gebiet der Geisteswissenschaften übertragen. Dieser war in der Tat
zum Dogma geworden, ja man hatte sogar ein Wort gefunden, welches das
Dogmatische der Angelegenheit besser zu fixieren vermochte: Monismus. Jeder
große Geist der vergangenen Jahrhunderte wurde auf seinen
möglichen Monismus hin geprüft, und Goethe galt vielen sogar
als einer unter den Erzvätern desselben. Die Annahme oder das
Bekenntnis oder die Aussicht, alles zusammen: daß die Schwere
eines Steines, der auf der Straße liege oder von einem Knaben
geworfen werde, und der Wille des Menschen ein und dasselbe seien oder
der weiteren Forschung im Verlaufe des Fortschrittes sich als ein und
dasselbe erweisen würden ganz am Ende, bedeutete schon Seligkeit
oder zum mindesten Vorwegnahme derselben, kürzer gesagt: den
Himmel auf Erden. Was sollte da noch Art und Form?
129
Ich
bin niemals Darwinist oder gar Monist gewesen, ich bin höchstens
einmal vor einem Monisten sehr erschrokken, als dieser in einer
Gesellschaft harmloser Menschen, Frauen und Männer, die Tee
tranken und Sandwiches dazu aßen, erklärte: Auch wir
Monisten haben, 1848 auf den Barrikaden stehend, unser Leben opfern
wollen und in der Tat auch geopfert. Genau so wie Jesus. Wo ist da cm
Unterschied? Es soll einer aufstehen und den Unterschied aufzeigen!
Niemand ist damals aufgestanden von den Teetrinkenden, auch ich bin
sitzen geblieben. Aus Feigheit oder um des großen Schreckens
willen, den mir der Monist mit seiner überaus endgültigen
oder endgültig scheinenden Erklärung über die Einheit
oder Einigung zwischen ihm selber oder einem aus seiner Schar von
Gesinnungsgenossen und Jesus Christus einjagte.
Obgleich aber dieser wahrhafte Schrecken meine Erkenntnis hätte
beschleunigen müssen und wohl auch beschleunigt hatte, bin ich
doch erst im Laufe der Jahre allmählich darauf gekommen,
daß, wenn die Welt tatsächlich nach dem Prinzipe Darwins
entstanden, oder auch so: wenn, populär und zugleich monistisch
ausgedrückt, alles eines wäre und einem jeden von den auf
Barrikaden herumpuffenden Männern nur durch Zufall die Kraft
gefehlt hätte, durch Jahrtausende als Symbol zu wirken, daß
dann, sage ich, auf Erden lauter Schimären umherlaufen oder
-hüpfen müßten, veritable Zwischenfälle,
Zwischenglieder, Summierungen von Eigenschaften, Summen, die sich
bewegen könnten, ohne daß dabei in einem fort Eigenschaften
abfielen und die Summierung zuletzt ganz verloren ginge, aber keine
Gebilde. Oder auch, aufs Geistig-Sittlich-Politische übergehend,
Narren, denen man die Waffen aus der Hand zu nehmen hat und
130
die
in Isolierzellen gehören. Darauf bin ich, noch einmal, erst
allmählich gekommen, ebenso wie zu meiner Konzeption der
Einbildungskraft, ohne welche es weder Gestalt, Spannung zwischen Art
und Einzelwesen, Inhalt und Form geben würde, noch auch einen
wesentlichen Unterschied zwischen Jesus Christus am Kreuz und dem
ersten besten oder meinetwegen: dem besten, dem tapfersten
Barrikadenkämpfer von Anno 1848. Ein Monist hat keine
Einbildungskraft. Kräftiger ausgedrückt: in Rücksicht
auf Einbildungskraft ist er ein Entmannter und der Zeugung
Unfähiger. Einbildungskraft ist für ihn Illusion,
Verführung, Distanz, Nichthaben, Fehlen, Massenwirkung und
Konfusion.
In Berlin hospitierte ich eine Zeit lang in den Vorlesungen über
Geschichte der Philosophie von Dilthey. Ich
kam nicht ganz mit, weil mir auch hier die notwendige Vorbildung dazu
gefehlt hat. Mit dem Namen Dilthey wird der Einbruch der
geisteswissenschaftlichen Methode verbunden, doch fehlte ihm nach
meinem Dafürhalten ebenso wie Henri Bergson
der wahre Begriff von der Form, und zwar darum, weil er den wahren von
der Einbildungskraft nicht besaß. Dilthey war noch zu sehr auf
Psychologie eingestellt, auf psychologische Inhalte, möchte ich
sagen, suchte dort, wo sich ihm ein Spalt oder Loch zu bieten schien,
einzuschlüpfen und sah nicht. Form muß gesehen, geschaut
werden, zur Form gehört die Distanz dazu. Form darf nicht
eingerissen werden. Form hat nirgendwo ein Loch oder einen Spalt oder
eine Ritze, in die einer hineinkann wie ein blutdürstiges
Frettchen in einen Kaninchenbau. Geschichte wird darum erst durch die
Einbildungskraft des Menschen zur Idee, will sagen: zu mehr als einem
Verlauf oder Ablauf von Ereignissen, zu mehr als einer Summierung von
Ereignissen in der Zeit.
131
Diltheys
Auge hatte den kahlen Blick eines solchen Frettchens, den kahlen Blick
dessen, der eindringen, einschlüpfen und drinnen meinetwegen auch
etwas wüsten will. Sein Auge war nicht das des Sehers mit der
Seherdistanz zu den Dingen, sondern es war so, wie wenn ein Werkzeug
einmal Augen bekommen hätte, richtige Werkzeugaugen. Und dazu
paßte der feste, gedrungene, kleine Kopf mit dem kurz
geschnittenen Haar und das zusammengeraffte Gesicht, das nicht feurig
war, aber doch aussah wie etwas, das im Feuer gelegen hatte und dann
ausgekühlt war. Und dem entsprach seine Rede. Wie riß er
darin und damit nicht bei Spinoza das
Richtige vom Unrichtigen weg oder von dem, was ihm so schien! Wie
grausam, mit wie kahlem, unsehendem Blick, den Körper nach vorne
geneigt, als ob er auch damit der Sache näher rückte und sie
besser in die Hände bekäme!
Sein Antipode schien mir Herman Grimm.
Ganz ohne Methode, auch nicht bemüht um eine, aus einer sehr hohen
Kultur heraus zu uns redend, sich auf Goethe berufend, auf Emerson,
auf seinen Vater, auf Kaiser
Wilhelm und Kaiserin
Augusta, vieles durcheinander werfend und doch wiederum dann dank
seiner großen Vornehmheit auseinanderhaltend. Er las damals ein
Kolleg über das Porträt. Als Gottfried
Kellers Porträt von Stauffer-Bern auf die Wand projiziert
wurde, sagte er nur: Sieht er nicht aus wie einer, der nach Tabak
riecht?
Im selben Saale wie Dilthey, wenn mich mein Gedächtnis nach
zweiundvierzig Jahren hier nicht im Stich läßt, nach oder
vor ihm hörte ich Heinrich
von Treitschke. Sein Auge war nicht so sehr sehend wie trunken. Das
War es in der Tat. Von allen meinen Lehrern auf beiden
Universitäten die einzige große Persönlichkeit, ein tyrtäischer
Mann. Die Trunkenheit seiner braunen Augen
132
ward
noch durch das Taube des Profils erhöht und wirkte darum
unmittelbar ergreifend. Treitschkes Erscheinung und Rede ist sicherlich
von vielen seiner Hörer in Briefen und Erinnerungen festgehalten,
letztere gelegentlich auch nachgeahmt worden von Virtuosen der
Nachahmung: wie sich die unartikulierten Laute eines, der sich selber
zu hören nicht imstande ist, erst allmählich im Mund, der
voll schien von solchen, als wären es große Kerne, zu
Wörtern formten und als Wörter und Sätze herauskamen,
während er im dunklen Jackett am Katheder stand, seine braunen,
etwas durchfetteten Glacéhandschuhe aufknöpfend und nicht
ohne eine gewisse Anstrengung von den kleinen, dicken, geröteten
Händen ziehend. Gerötet war sein starker Hals, waren die
ungeformten Backen, auch die ein wenig dickhäutige Stirn, das
gräuliche Haar völlig ungelockt und fett glänzend. Alles
an ihm schien gedrungen und nicht gelöst. Wie mir schien, um der
Trunkenheit des Auges und des tauben Gehöres willen. Auge und Ohr
vertrugen sich bei ihm sozusagen erst im Mund, der zugleich beredt und
geschwollen schien. Seine Rede war voller Ausfälle, im besonderen
gegen England, gegen die Königin Viktoria,
die er auf eine ganz ungehörige Weise der Neigung zum Trunke zieh,
gegen Österreich, vornehmlich gegen Wien, gegen Metternich,
gegen alle kleinen Staaten. Seine Bewunderung galt außer
Preußen den Franzosen, Cavour,
aber auch den Magyaren und ein ganz klein wenig den Tschechen, zum
mindesten deren hussitischer Vergangenheit und soweit sie in Opposition
zu Wien oder den ‚backhändelessenden‘ Österreichern gestanden
hatten. Sein Abgott war Friedrich
der Große, dessen Vater er einmal ein ‚borniertes Genie‘
nannte. Es fehlte ihm aber darum nicht an Mut dem preußischen
Königshause gegenüber. Er sprach in
133
einem
seiner letzten Kollegs wenige Tage vor seinem Tode einmal von der
‚traditionellen Undankbarkeit‘ der Hohenzollern, von welcher er allein
Friedrich II. ausgenommen wissen wollte.
Treitschkes Familie kam, wie ich erst viel später gehört
habe, aus Deutschböhmen, aus dem Siedlungsgebiet, das heute
Sudetendeutschland genannt wird und aus dem die Vorfahren Rainer Maria
Rilkes stammten.¹ Mein Vater war nach Südmähren gezogen
und hat sich in einem östlich von der Thaya gelegenen Gebiet
unweit von den Pollauer Bergen mitten unter Slawen niedergelassen, ein
großer Landwirt und Mann der Zuckerrübe. Meine Onkel und
Vettern väterlicher- und mütterlicherseits lebten in beiden
Schlesien auf größeren oder kleineren Gütern, waren
deutschnational gesinnt und hielten zu Bismarck.
¹ Ich habe schon einmal in der Quadratur des Zirkels (Das physiognomische Weltbild) von
meiner Herkunft gesprochen und füge hier noch das Folgende bei:
Aus den von einem meiner schlesischen Vettern durchforschten
Kirchenbüchern jenes Zipfels des alten Österreich-Schlesiens,
das nordwestlich von Jauernig sich in das Preußische
hineinspitzt, ergibt sich, daß alle Latzels, meine Vorfahren
mütterlicherseits, Bauern waren bis ins 15. Jahrhundert herunter,
und zwar ganz ausnahmslos. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts an und
schon früher gab es dort wenig Dörfer, darin nicht neben
meinem Großvater einer von meinen vielen Onkeln, Großonkeln
ein mehr oder weniger großes oder kleines Gut mit einem
Herrenhaus besaß. Die Vorfahren meines Vaters waren Bürger,
Kaufleute, Beamte kleiner Städte in den angrenzenden Kreisen des
preußischen Schlesiens, und es scheint, daß jeder von ihnen
etwas Grund und Boden vor den Toren der Städtchen sein eigen
nennen durfte. Mein Vater war, nach Mähren ziehend, am weitesten
nach dem Süden gelangt und war noch, bevor ich geboren wurde,
Österreicher geworden und hatte sich als Österreicher
gefühlt; er liegt in Groß-Pawlowitz begraben. Seine beiden
Schwiegersöhne, die Söhne des älteren von beiden, meine
Schwäger und Neffen, hatten und haben noch hohe Posten im
deutschen Heere inne, so daß es den Anschein haben könnte,
als hätte er sich damit von seinem Vaterland losgekauft.
134
Ein
Bruder meiner Mutter, der Schönererpartei
im österreichischen Abgeordnetenhaus angehörend, hatte an
einer der Pilgerfahrten des Parteiführers nach Friedrichsruh
teilgenommen, wohl kaum ahnend, daß nach vielen, vielen Jahren
einmal einer seiner Neffen lange nach dem Tode des gewaltigen Mannes
der edelsten Gastfreundschaft an dieser Pilgerstätte der Deutschen
genießen sollte. Wir Mährer aber, nahe von Wien in dessen
Bannkreis lebend und dem großen Einfluß und der Einwirkung
der über alle Vorstellung zauberhaften Stadt von damals
unterliegend, waren mehr österreichisch gesinnt und hatten heftige
Kämpfe mit unseren schlesischen Vettern zu bestehen. Und doch war
es Treitschke und dessen hinreißender Beredsamkeit gelungen, mir
das alte Preußen und Friedrich II., auch dessen Vater, eben das
‚bornierte Genie‘, nahe zu bringen und mich das alles so fühlen zu
lassen, wie er wollte, daß es von jungen Menschen, jungen
Deutschen gefühlt werde.
10
Aus Treitschkes Mund ist zum ersten Mal in meinem Leben das Wort Macht an mein Ohr gedrungen. Es ist
in der Tat so gewesen, wie ich es niederschreibe: ich hatte das Wort
vorher nicht zu hören bekommen. Es war unterschlagen,
verschwiegen, umgangen worden in den Jahrzehnten des Liberalismus. Oder
es hatte sich für den Österreicher im Begriff der
habsburgischen Hausmacht verhärtet. Ich weiß nun sehr genau,
wie mich das Wort und der Begriff Macht samt allem, was daran hing,
betroffen machte, ich habe da etwas Neues gefühlt, eine neue Idee
von beträchtlicher Durchschlagskraft, ich empfand darin einen
neuen Lebensstil, eine größere ‚Aufrichtigkeit‘. Das war
überhaupt ein Wort, das ich im
135
Umgang
mit mir selber oft im Sinne und im Verkehr mit anderen im Munde
führte: aufrichtig, Aufrichtigkeit. Darunter ging dann allerlei
Disparates: die durch Ruskin
verbreitete Idee von der Echtheit des Materials, woraus das groteske
Mißverständnis der ganzen Kunst des 18. Jahrhunderts
hervorging, der Realismus mit seiner Unbilligkeit gegen das, was etwa
Schillers Art ausmacht, die Abneigung gegen falsche, unechte Metaphern
in der Dichtkunst, gegen eine Metaphorik, die nicht aus der Sprache
selbst gezogen ist, gegen eine Dichtkunst, die neben dem Leben
einherginge und dieses nicht in sich aufnähme. ‚Aufrichtig‘
schienen mir also: Ruskin, die sehr überschätzten
Präraffaeliten, die großen Russen, Treitschkes Apologie der
Macht und der Mächtigen, aber auch Hofmannsthals frühe
Gedichte, darin die Metapher das primär Gegebene und nicht die
Verkleidung von etwas anderem vorstellte. Ich weiß heute noch,
wie um die Jahrhundertwende André Gide
im Gespräch mit mir sich gegen diesen meinen Begriff der
Aufrichtigkeit (sincère)
kehrte und ihn gar nicht aufgenommen haben wollte in das Vokabular
seiner, meiner, unser aller, kurz der neuen Ästhetik. Sicher ist,
daß die Franzosen darum einen anderen Begriff von Aufrichtigkeit
besitzen, weil sie einen anderen von Konvention haben. Das, was bei
ihnen artiste heißt,
beruht auf der Einigung, Einheit des ‚Aufrichtigen‘ und des
Konventionellen. In diesem Sinne müssen die Deutschen, wenn sie
wirken wollen, ‚aufrichtiger‘ sein, weil ihnen jede Konvention fehlt
oder weil sich bei ihnen Konvention und Mittelmäßigkeit
decken. Oder in diesem Sinne gelingt es ihnen leichter, sich selber als
andere zu belügen.
Auf eine zauberhafte Art und Weise, unser Staunen nie erschöpfend,
sind Macht und Konvention im Barock in-
136
einandergeschlungen.
In den neunziger Jahren aber war das Barock noch nicht so eingesehen
wie später, war es weder von den englischen Ästhetikern noch
von Treitschke, schon gar nicht von den Franzosen verstanden, am
allerwenigsten aber von Carlyle. Der
damals noch, zum letzten Male, wie es scheinen möchte,
Einfluß ausübte auf junge Menschen. Es kann in der Tat so
formuliert werden, daß die Macht des Schotten nicht nur über
mich, sondern mehr oder weniger über alle im europäischen
Geistesleben zu sinken begann, da ein besseres Verständnis des
Barock und damit des Katholischen, auch des magischen Elementes in
allem Religiösen aufkam. Der Held (hero) Carlyles mit seinen
Ansprüchen auf Verehrung, auch sein Ableger, Emersons
‚repräsentativer Mensch‘, sind beide etwas gänzlich
Unbarockes, ja dem Barocken Feindliches. Eine Figur wie die des Prinzen
Eugen ist damals unverstanden geblieben. Es gehört zu den
Paradoxieen des Geschichtlich-Menschlichen, daß man die Idee des
Barock in dem Maße besser erfaßte, ja dieses um so mehr
liebte, als der von Gott erkorene Träger desselben, das alte
Österreich, sich seinem Untergang näherte.
Wer hat, um das an dieser Stelle einer Schrift, der Erinnerung geweiht,
vorzubringen, wer hat den lebendigen Zusammenhang von Männern und
Ideen der Geschichte, wer hat somit Geschichte im einzigsten Sinne so
erleben können wie die Menschen, welche gleich mir heute zwischen
sechzig und siebzig in der Mitte stehen? Niemand, auch nicht die
Menschen um 1793 oder 1815 oder 1648 oder 1517. Aus einem bestimmten
religiösen Empfinden heraus habe ich mich dagegen gesträubt
im Geiste, Geschichte und Tragödie zusammenzukoppeln, vom
Tragischen des geschichtlichen Verlaufes zu reden, aber so viel
muß denen, welche das Tragische aller Geschichte
137
gerne
apostrophieren, zugestanden werden, daß Geschichte noch niemals
vorher der Tragödie so ähnlich gesehen habe. Auf alle
Fälle steht fest, daß Umkehr, Peripetie Erscheinungen des
Tragischen bedeuten. Nun behaupte ich, daß die bessere Einsicht
aus dem Machtmenschen des scheidenden 19. Jahrhunderts, aus dessen
Idee, aus Bismarck, dem hero
Carlyles, den ‚Geschichte bildenden‘ großen Männern Heinrich
von Treitschkes und den neuen Herrschaftsformen, der deutlichere
Begriff davon, zwischen ihnen liegt: im Barockmenschen, — daß
sich gleichsam an ihm, am Menschen des Barocks, wenn wir ihn richtig
sehen, an dessen Bild, rein zeitlich genommen, jene Wendung vom einen
ins andere vollzogen hat. Wovon eine von mir angedeutete Staatslehre
später handeln soll.
Der Unterschied zwischen unserer Zeit und jener um das Jahr eins aber
ist der, daß die Menschen damals, als aus der Zeit selber der
Glauben geboren ward, die Zeit, welche sie lebten, die Geschichte als
solche nicht einsehen konnten. Wohl um eben des Glaubens willen, der
damals der Menschenzeit entsprungen ist.
11
Treitschkes Vorlesungen dürfen für mich als eine Art
Vorbereitung für Nietzsche gelten, wozu gleich bemerkt werden
soll, daß damals um 1895 herum weder der Lehrer noch der
Schüler von Nietzsche viel mehr als den Namen wußten.
Treitschkes Machtbegriff war ein rein politischer, in keinem
Widerspruch befindlich mit der Idee von der Freiheit des einzelnen
Individuums, hervorgegangen aus der Vielfältigkeit des
geschichtlichen Lebens, der verschiedenen Begabung und geographischen
Lage der Völker. Treitschkes Machtbegriff war gegen die politische
138
Utopie,
gegen das Utopische im Liberalismus, auch im reinen Idealisten, war
letztlich nur ein prägnanter Ausdruck für Realismus,
Realpolitik und so weiter.
Nietzsches Machtbegriff hat ungleich tiefer gehende Wurzeln und kommt
direkt aus Schopenhauers Willensbegriff. Ich habe mich im Innern sehr
lange gegen Nietzsches Willen zur
Macht gewehrt und darin eine Verflachung oder, wie ich mich
damals ausdrückte, eine Allegorie des Schopenhauerschen Willens
zum Leben sehen wollen, bis ich gefunden habe, und zwar spät, da
ich lange, lange Nietzsches Bücher nicht in die Hand genommen,
daß er, so wie er ist, herauswächst, herausragt aus
Nietzsches besonderem Nihilismus: Es
gibt keine Wahrheiten, oder daß er darin steckt wie eine
Fahnenstange mit flatterndem Wimpel im Gemäuer eines alten Turmes.
Nietzsches Nihilismus ist ein deutscher Nihilismus, die
leidenschaftliche, die gereizte Leugnung einer metaphysischen Welt, und
darf nicht mit dem russischen verwechselt werden, der tiefere Schichten
des Menschlichen aufgedeckt hat.
Nietzsche ist ein Schicksalsmensch erster Ordnung, und so ist sein
Buch: Der Wille zur Macht ein
Schicksalsbuch. Sind nicht alle großen Deutschen
Schicksalsmenschen, sind sie es nicht ungleich mehr als große
Franzosen oder auch große Engländer? Ich bin der Meinung,
daß dieses Schicksalhafte der großen Deutschen mit der
besonderen deutschen Einstellung zur Zeit zusammengeht, mit dem
eigentlich Unzeitgemäßen des großen Deutschen, mit der
langen Verkennung, der späten, immer wieder wechselnden Wirkung,
damit also, daß der Deutsche oft erst mit seinem Tode geboren
wird und dementsprechend dann weiterwächst, abnimmt, wiederum
wächst...
139
Nietzsche
ist der Mann der Weltwende zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert,
keiner kann neben ihm als das gelten, und so ist dieses eine Buch das
einer Weltwende, sooft ich es aufschlage. Noch gestern abend fand ich
die Geschichtsphilosophie Spenglers in
einem einzigen Satz darin vorweggenommen. Spengler war ein Mann von
sehr großem, von durchaus überlegenem Verstand und gar
keinem Geschmack, ein Un-schmeckender, was sich in seinem rohen Stil
unmittelbar verrät. Was bei Spengler wie ein Schmecken der Dinge
aussieht, ist nur scheinhaft. Es hat nur den Anschein, als ob er
schmecke. Freilich schließt ein gewisses Prophetisches in ihm,
das nicht geleugnet werden soll, das wirkliche Schmecken der Dinge aus.
Propheten schmecken nicht. Ob solche Menschen, frage ich, nicht viel
heftiger der Beeinflussung durch andere unterliegen, als sie es selber
oder als es ihre Schüler wissen oder wahrhaben wollen? Ob sie
nicht von den Ideen anderer direkt unterminiert werden? Spengler
erscheint mir oft so ein Unterminierter zu sein, was auch daran, von
außen gesehen, bevor es also zu einer Explosion kommt, zu
erkennen ist, daß er eigentlich keine Form hat. So etwas ist
immer gefährlich: wirklich formlos sein. Eben um möglicher
Explosionen und der davon verursachten Schäden willen.
Ich habe die Geburt der Tragödie
nie ganz einsehen können, sie scheint mir nicht durchsichtig
genug, die Analogieen mit der modernen Oper und dem Musikdrama sind
gewollt, künstlich und im letzten falsch. Und doch ist es ein
wunderbares Buch, das Buch einer ‚neuen Seele‘ und mit einer solchen
und in seiner Bedeutung mit den Romanen Tolstois und dessen neuer Art,
Körper und Seele zusammen zu sehen, und mit nichts anderem zu
vergleichen. Hier wird nicht erklärt, sondern gedeutet, zum
140
ersten
Mal gedeutet, aus dem Mythischen gedeutet, und zwar so, daß von
jetzt an nur noch Deutungen aus dem Mythischen, aus der
Gegenwärtigkeit des Mythischen gültig sind. Nietzsche ist
jener Durchbruch vom Geschichtlichen ins Mythisch-Metaphysische
gelungen, welcher Herder, mit dem Nietzsche noch am ehesten verglichen
werden kann, versagt blieb. Damit war eine neue, aus dem tiefsten Wesen
des Menschen heraus freie Betrachtung der Geschichte gegeben ohne alle
Willkürlichkeiten und ohne das Zufallhafte, das dem Diltheyschen
Geschichtsbegriff noch anhaftet.
Ich habe Nietzsches Bücher der Konversion zum Freigeist (Menschliches — Allzumenschliches, Fröhliche Wissenschaft, Morgenröte usw.) immer eher
langweilig gefunden, Also sprach
Zarathustra formlos und in seiner Formlosigkeit direkt
unglücklich. Ich kann es nicht anders sagen. Letzteres ist ein
Buch ganz und gar ohne schöpferische Mitte, darum so entsetzlich
aufdringlich, zudringlich, laut. Die Leichtigkeit oder, wie Nietzsche
sagen würde, die Leichtfüßigkeit darin ist scheinbar,
ist die Folge einer großen Überanstrengung, eines
schauerlichen Sichübernehmens. Es ist ganz und gar nicht ein
wahnsinniges Buch, aber das nächste wird es sein, kann es sein. Je
mehr ich den Wahnsinn in den nächsten, in den letzten Büchern
zu spüren meinte, um so aufmerksamer wurde mein Ohr, und um so
wichtiger erscheinen mir diese nächsten, letzten. Gleich von
Anfang an. Damals, als ich sie in Göggingen in der Hessingschen
Anstalt zu lesen begann. Welche Ursachen dieser Wahnsinn immer gehabt
haben mochte im Physischen, im Zufälligen, im Arbiträren
eines armen Menschenlebens, er war schicksalhaft. Nietzsches Seele lief
in ihm aus, genau so wie seine Idee des Geschichtlichen aus dem
Mythischen
141
entsprang.
Nietzsches Wahnsinn war dessen Mythisches, und so besteht, über
den Wahnsinn hinüber, hinweg, eine wundervolle
Übereinstimmung zwischen Mensch und Werk trotz Zarathustra und den
Büchern der Konversion.
Es war unschön und in hohem Grade ungenerös von Bayreuth und
dem, was sich daran gehängt hatte, in diesem schicksalhaften
Wahnsinn Nietzsches den Ausdruck gekränkten Ehrgeizes, das Ende
der Nacheiferung eines absolut und wesentlich Ungenialen, zur
Ungenialität Verdammten zu erblicken, Neid, der endlich birst. Ich
komme darauf, weil ich in dieser Sache persönlich berührt
erscheine, und zwar im Rahmen eines der Briefe
aus der im Jahre 1934 veröffentlichten Korrespondenz zwischen Houston
Stewart Chamberlain und Cosima Wagner.
Die Szene ist folgende: Chamberlains Studierzimmer in der
Blümelgasse 1, Wien VI, im vierten Stock, der Indologe Leopold von
Schroeder und ich sind zu Gast. Ich werde im Briefe mit Namen nicht
genannt und figuriere als der ‚ungewöhnlich begabte‘ junge Mann,
der in London und Paris gelebt und ein Buch über englische Dichter
und Mystiker geschrieben hat. Leopold von Schroeder, ein geistig
keineswegs sehr beträchtlicher Mann, den Chamberlain vielleicht
gerade um dessen Harmlosigkeit willen gerne leiden mochte, findet es
plötzlich im Gespräch sehr traurig, daß das deutsche
Volk sich einen Wahnsinnigen zum Lehrer gewählt habe. Damit
Nietzsche meinend. Worauf ich, der junge Mensch, der Vertreter der
Jugend von heute, als welcher ich Frau Wagner mit den notwendigen
Vorbehalten im Briefe vorgestellt werde, aufgesprungen sei und eine
Verteidigungsrede eben auf Nietzsches Wahnsinn gehalten, gerade diesen,
den Wahnsinn, für wesentlich, wichtig, sinnvoll,
142
notwendig
und höchst genial oder als Ausdruck des Genialen ausgegeben habe.
Nachdem ich diesen Unsinn von mir gegeben, hätte ich neuerdings
gar Sinniges über andere Männer wie Diderot, Voltaire
gesprochen...
In ihrer Antwort auf diese Schilderung schreibt Cosima Wagner
ungefähr so: Ihr junger Mann (ich also) erinnere sie an jenen
Jüngling in einer Erzählung des Don Quijote, der ganz
vernünftig und sinnvoll rede und erzähle, bis er mit einem
einzigen Wort verrate, daß er wahnsinnig sei.
Nietzsche ist der Ohrmensch unter den großen Philosophen; ich
wüßte keinen anderen daneben zu nennen Höchstens noch Giordano Bruno.
Nietzsches Stil, auch seine Rhetorik, seine Bilder, wo solche
vorkommen, die Unform des Zarathustra, endlich das entschieden
Prophetische seiner Rede und seiner Seele verrät mir den
Ohrmenschen. Und aus diesem Ohrmenschentum leite ich sein geringes,
nein: sein fehlendes Verhältnis zur Zahl ab, wie ein solches
Augenmenschen eignet, und zwar im allerhöchsten Maße dann,
wenn der Augenmensch Denker ist oder wird. Nietzsches unmögliche
Idee von der Wiederkehr des Gleichen ist die Idee eines Ohrmenschen,
drückt das Fanatische eines Menschen aus, der in die Ewigkeit
hineinzuhören, zu horchen sucht. Nur so vermag ich ihr einen Sinn
abzugewinnen. Nietzsches Meister war der wahrhaft große Heraklit. Statt der
Wiederkehr des Gleichen steht bei dem frühen Griechen die Idee des
‚großen Feuers‘, die gleich allen echten, gleich den
‚möglichen Ideen‘ aus Auge und Ohr, aus beiden, kommt oder beides
bindet.
Nietzsches Unverhältnis zur Zahl hängt sehr deutlich zusammen
mit seiner Psychologie, besser: mit zwei psychologischen Ideen, die ihm
ganz allein angehören und die auf mich in meiner Jugend eine
starke Wirkung aus-
143
übten.
Die erste Idee läßt sich in der Frage zusammenfassen, ob
wir, ob die Künstler aus Überfluß oder aus Not
schöpferisch seien. Und die zweite in der Behauptung, daß
wir die Dinge beschenkt haben mit unserer, mit ihrer Schönheit und
daß es somit jetzt darauf ankomme, das von den Dingen
zurückzuerhalten, womit wir sie beschenkt oder auch was wir in sie
hineingedeutet haben, daß es, kürzer gefaßt, unser
Geschäft für alle Zukunft bleibe, die Dinge aus dem Himmel,
den ganzen Himmel auf die Erde zurückzubringen, da das alles
dorthin gehöre, woher es gekommen und genommen sei: auf die Erde.
Dieser zweite Programmpunkt hat den Individualisten der neunziger Jahre
noch mehr zu gewinnen gewußt als der erste, da er ein
Allgemeineres, ein Allgemeinstes zu erfassen schien. Mit ihm, meinte
er, sei der Idealismus ein für allemal überwunden und an
dessen Stelle ein dreifaches getreten: Psychologie, Realismus und
Sozialismus.
Und doch stimmt da etwas nicht, fiel mir bald auf, ist da etwas falsch,
und es sollte meine Aufgabe für die nächste Zeit sein, darauf
zu kommen: auf das Falsche. Ich kann das, was folgt, hier nicht so
ausführen, wie ich möchte und auch sollte, da darin ein
Erziehungs- und ein Seelenproblem allererster Ordnung liegt oder
richtiger: dieses Erziehungs- und Seelenproblem von einem neuen
Menschen ausgeht und darum auch nur neue Menschen angehen kann. Ich
behaupte nämlich, daß der letzte Sinn der Zahl, wenn wir uns
die Mühe nehmen, Zahl groß zu sehen, der sei: Trennung von
Himmel und Erde, Verhinderung einer Konfusion, eines
Zusammenfließens beider. Statt Trennung darf auch Spannung
stehen, Stufung, Leiter. Man muß nun eine sehr
ursprüngliche, eine erste Einstellung zur Zahl, zum Zahlhaften
haben, wie
144
sie
die frühen Menschen am Morgen der Welt, wie sie etwa die Pythagoräer
noch gehabt haben, eine ganz und gar religiöse, um die Bedeutung
dieses Satzes einzusehen und zu fühlen. Und hier muß ein
persönliches Eingeständnis erfolgen, daß mir
nämlich das Glück zuteil geworden sei einer solchen
ursprünglichen, einer solchen ersten Einstellung zur Zahl, zum
Zahlhaft-Zahlenmäßigen. War es nicht tatsächlich so und
nicht anders, daß ich mich durch Jahre hindurch in sehr
heimlichen Augenblicken darüber wunderte, warum Zahlen vorkommen
da und dort, warum nicht plötzlich einmal statt eines
Kieselsteines eine Zahl am Wege daliege, so daß ich mit dem
Fuße darauf stoßen müßte?
Dieses Erstaunen war sehr heftig in mir gewesen, es würde aber
seines letzten Sinnes ermangelt haben und möglicherweise nicht
viel mehr als die Ausschweifung ins Seelische eines von meinem Vater
ererbten außerordentlichen Zahlengedächtnisses gewesen sein,
wenn damit zusammen nicht ein anderes Erstaunen in meinen Jugendjahren
gegangen wäre und beide Erstaunlichkeiten nicht ineinander
gegriffen hätten, wie die Finger der rechten Hand in die der
linken greifen oder wie ein Pol am anderen hängt. Dieses andere
Erstaunen galt — ach! es war immer da durch Jahre, mir oft gar nicht
bewußt, gleichwie wir, wenn wir gehen, nicht auf den Schatten
achten, den unser Körper wirft —‚ dieses andere Erstaunen also
galt dem schier unbegreiflichen Umstand, daß ich ich sei, dieses
andere Erstaunen sprang stets in die Frage über, warum ich statt
in mir nicht in einem Baum, einem Tier, im Wasser, in irgendeinem Ding
außerhalb von mir selber sei, welcher Baum, welches Tier, Wasser,
Ding alle mehr Realität hätten als ich selber in mir. Es
würde falsch, vage, auch lächerlich sein,
145
vor
allem aber ungenau, das mit Pantheismus und ähnlichcn
Schulausdrücken zu bezeichnen, welche ich um des Vagen willen mein
ganzes Leben lang gemieden habe. Ich bin zu keiner Zeit irgend etwas
dergleichen gewesen oder habe mich so zu nennen beliebt, sondern die
beiden Wege des Erstaunens der Seele bedeuten deren ewiges, unendliches
Drama und Handlung und nichts anderes, zeichnen vor unserem Blick die
Gestalt der Seele ab, der anfangs- und endlosen, oder heben deren
Gestalt als solche heraus.
Was in der Ewigkeit aneinander gebunden ist oder ineinandergreift wie,
um zum Bild zurückzukehren, die rechte und die linke Hand des
Menschen, das liegt in der Zeit auseinandergerissen da, wenn wir darauf
achten. Mit meinem großen Staunen darüber, daß ich in
mir selber und nicht ebenso in einem Baum oder Ding, oder mit der
Frage, ob ein Baum oder Ding nicht mehr, nicht wirklicher wäre als
ich in mir selbst, ging gut zusammen, daß mich Nietzsches Idee
von der Beraubung unserer selbst durch die Dinge, die Idee, daß
die Dinge von uns, von unserer Substanz lebten, und ähnliches in
ihm festhielt. Welcher Halt so lange dauerte, bis sich mir jener
obgenannte letzte Sinn der Zahl von einer Trennung zwischen Himmel und
Erde, Himmel und Hölle, Erde und Gestirn langsam eröffnete.
Und damit hatte ich für mich vorläufig einen sehr
entscheidenden Begriff gewonnen: den des Maßes. Das da ist, um
auseinanderzuhalten und zu binden: beides zugleich. Der staunenden
Seele meiner Jugendjahre hatte dieser Begriff gefehlt. Oder die
Menschen hatten ihn mir schlecht gemacht, so daß ich ihn nicht
wollte. Melancholia ist der
Titel jenes Buches, mit dem ich meine Jugendzeit, wie mich dünkt,
beschlossen habe, und in dieser Melancholia
ist das ent-
146
halten
als deren Mitte, daß das Maß, daß die Idee des
Maßes fehlt, weshalb sich in ihr der Mensch verzehrt, nicht
anders als sich ein Kreis in sich selber verzehrt. Was ganz und gar in
der Komposition des Werkes herauskommt, worin das erste Gespräch
oder Gleichnis mit dem letzten, das zweite mit dem vorletzten, das
dritte mit dem drittletzten korrespondieren. In der Mitte steht dann
das lange Gespräch oder Drama zwischen dem Menschen und dem
Gliedermann, und die Mitte dieser Mitte bildet das Gleichnis von jenem
Menschen oder Erznarren, der seine Besitztümer nicht
verschließt, weil seine Welt ohne Schlüssel ist, sondern
höchst sinnvoll versteckt, und zwar aus Einbildungskraft.
Als ich Die Elemente der
menschlichen Größe schrieb, hatte ich mich in meiner
Gesinnung am weitesten von Nietzsche entfernt und stand ich dessen Welt
fast feindlich gegenüber. Auch war darin aus dem Individualisten
ohne Ende der neunziger Jahre für mich das geworden, was ich, das
Buch einleitend, den ‚indiskreten Menschen‘ nenne. Der dann wenige
Jahre darauf in den Weltkrieg zog, um zu siegen und besiegt zu werden.
Hüben und drüben. Ich kann das heute nicht anders sehen. Es
hat sich etwas Ähnliches früher nicht so zugetragen,
daß Sieg und Niederlage so ineinander eingegriffen hätten.
Woraus gleichfalls eine gewisse Maßlosigkeit innerhalb des
Menschlichen, ein kreishaft Melancholisches in einem ganz neuen Sinn
spricht.
Wenn ich mir heute nach ungeheuersten Geschehnissen den
Individualisten, den Indiskreten vor dem Weltkrieg noch einmal, so
deutlich wie es nur irgend geht, vergegenwärtige, so scheint mir
seine Formel, soweit er auf eine solche gebracht werden kann, die
gewesen zu sein: Höchster Egoismus ist höchster Altruismus
und umge-
147
kehrt.
Eine Formel, die aus Nietzsche zu gewinnen und mit der ein Monist
leicht zu bezaubern war. Meine Idee vom Maß war nun dazu da, um
dazwischen eingekeilt zu werden und beides so auseinander zu halten,
wie die heilige Zahl Himmel und Erde auseinanderhält. Damit
Ordnung und Sinn da sei und nicht alles, Welt- und Menschengeschehen,
auf eine kolossale Indiskretion und Sinnlosigkeit hinauslaufe. Das
sollte durch das Maß hintangehalten werden. Dieses sollte aber
noch mehr leisten, aus ihm oder aus seiner Idee sollte die Idee der
Umkehr für den hervorgehen, der einmal die Beziehung der Einheit
zum Unendlichen und weiter, daraus entspringend, die Idee der
weltschöpferischen Einbildungskraft einzusehen gelernt hat.
12
Man wollte Künstler sein um die Jahrhundertwende. Alle wollten es
sein, auch Kaufleute, Industrielle wollten es bei Gelegenheit oder
Leute, die genug Geld hatten, um Monate in den besten Hotels der
europäischen Hauptstädte zu verbringen. Man hatte auch bald
das Wort ‚genial‘ bei der Hand. Das konnte einem gar schnell passieren,
daß man für genial ausgegeben wurde unter Freunden, für
einen genialen Arbeiter etwa, wenn die Freunde das Gefühl hatten,
daß man nicht unbedingt unter die Allergrößten zu
zählen sei. Diese ganze Genialität kam von weither, von
Wagner, von noch weiter: von Schopenhauer. Nach der Lektüre
Schopenhauers glaubte mancher sich dafür vor aller Welt
entscheiden zu müssen, ob er unter die Genies zu zählen sei
oder nicht. Es gab sicher viele, die lieber unglücklich sein
wollten als keine Genies.
Das mußte vorbeigehen, es war nichts dagegen zu
148
machen,
und es ist auch vorbeigegangen. Man hatte zudem gar keinen Geschmack,
man war in der Tat aus lauter angenommener Genialität sehr
geschmacklos. Als Beweis genüge ein Blick auf die schauerliche
Architektur der Jahrhundertwende. Man wollte wohl genießen, es
gab auch Anweisungen dafür. Zum Genuß fehlte es aber an
Vernunft, fehlte es an einem gewissen Rationalismus. Der
Genießende braucht nämlich eine Art von Schutz, damit er
nicht auseinandergehe, ausfließe, und diesen kann ihm nur eine
Portion Rationalismus gewähren. Man denke an die Chinesen, die im
Genuß tiefsinnig werden, die Franzosen, die Menschen des 18.
hunderts.
Das Genie genießt nicht so ohne weiteres. Auch das, was sich
Genie nennt, dilettiert im Genuß, kommt nicht bis zum
Genuß, spricht höchstens davon oder schreibt Artikel
darüber. Oder erlebt. Die Epoche zog das Erlebnis dem Genuß
vor, und zwar aus einer gewissen feindlichen Einstellung gegen die
Vernunft, gegen das Vernünftige. Was gleichfalls von weit, von
noch weiter herkommt: von Kant möchte ich sagen. Wo liegt der
Unterschied zwischen Genuß und Erlebnis? Wer im Genuß oder
durch ihn seinen Charakter gefährdet, der hat oft das und das
erlebt und das und das nicht genossen. In der Tat habe ich gefunden,
daß die sogenannten Genießer, die Genießenden oft
mehr Charakter haben oder ihren Charakter besser bewahren als die
Erlebenden. Was sicherlich auch mit der damals grassierenden Form des
‚Genies‘ zusammenhängt.
Es ist begreiflich, daß man damals mitten unter ‚Künstlern‘,
‚Schaffenden‘, ‚Schöpferischen‘, in einer höchst
literarischen Epoche also, eines lernen mußte: den Schluß
vom Werke auf den Schöpfer. Womit der Psy-
149
chologe
an die Stelle des Philologen getreten ist und die Fragen nach dem
Einfluß und ähnlichem eingestellt werden mußten. Der
Philologe war rein historisch orientiert und mit fortlaufenden Daten
beschäftigt, der Psychologe aber hat ‚Geschichte‘ mit ‚Leben‘
vertauscht. Man muß den Individualismus mit dem Begriff des
Lebens zusammendenken, wenn man ihn richtig erfassen will. Ich mochte
letzteren nicht, instinktiv nicht, ich scheute mich ihn auszusprechen,
das ‚Leben‘ kam mir wie ein Ding ohne Enden vor. In Indien habe ich
einmal im Korbe eines Schlangenbändigers eine gelblichrosa
Schlange liegen sehen, bei der nicht gleich auszumachen war, wo der
Kopf und wo der Schwanz wäre. So sah ich in dem Leben, von dem
fortan die Rede war, ein Ding ohne Enden. Und ich habe erst sehr viel
später gelernt, was diesem vielgebrauchten Lebensbegriff gefehlt
hat, für mich, für meinen Instinkt und mein Gefühl: der
Traum, das Traumelement, die Innenseite oder auch so: die Enden des
Traumes. Davon habe ich in meinem Aufsatz über Hugo von
Hofmannsthal im Physiognomischen
Weltbild gesprochen, und darauf will ich mich hier berufen. Was
aber dort explizite vorliegt, war in meinem ersten Buch, das den
später von mir verworfenen Titel Die
Mystik, die Künstler und das Leben führte, implizite
schon vorhanden und brauchte später nur aufgewickelt zu werden.
Mit diesem meinem ersten Buch ist für mich der Name eines Mannes
verknüpft, der heute dank seinem ersten Werk weltanschaulichen
Inhalts zu größter politischer Bedeutung gekommen und dem
darum aus persönlichen und weltgeschichtlichen Gründen ein
paar Seiten gewidmet werden sollen. Ich hatte das genannte
Erstlingswerk aus meinem völligen Alleinsein heraus neben an-
150
deren
von mir geehrten und geschätzten Geistern auch Houston Stewart
Chamberlain von Paris aus geschickt, wohin ich um die Jahrhundertwende
zu längerem Aufenthalt gezogen war, und nach einiger Zeit von ihm
den freundlichsten Dank erhalten, Sätze enthaltend voll
Anerkennung und Ermunterung, welchem später die Aufforderung
folgte, ihn zu besuchen, sobald ich wieder nach Wien zurückgekehrt
wäre. Was alles nach ungefähr einem Jahr geschah und einen
freundschaftlichen Verkehr zur Folge hatte, der bis zum Frühjahr
1908 andauerte, da ich um diese Zeit zuerst nach England, dann nach
Indien ging und Chamberlains Schicksal es so fügte, daß er
Wien für immer mit Bayreuth vertauschen sollte. Ich sah ihn das
letzte Mal im Leben von Angesicht zu Angesicht in meiner Wohnung in
Hietzing, da ich ihm an zwei Abenden meine Melancholia vorlas, die eben
erschienen war. Der geänderte Schluß des Doppelgängers in der zweiten
Auflage geht auf seinen Rat zurück, wofür ich ihm heute noch
dankbar bin. Wir haben später Briefe und unsere Bücher
getauscht bis zu meinem Zahl und
Gesicht, worauf von ihm keine Antwort mehr kam. Meine geringe
naturwissenschaftliche Bildung hatte Chamberlain stets ein wenig Kummer
bereitet, und die Versicherung meinerseits, daß ich die Hoffnung
hege, in meinen Arbeiten aus dem Gefühl heraus nie gegen die
Gesetze der Naturwissenschaft zu verstoßen, vermochte ihn wenig
zu trösten. Nun waren Zahl und
Gesicht, woran ich drei Jahre gearbeitet habe, fast zwei Jahre
einer ziemlich intensiven, einer leidenschaftlichen Beschäftigung
mit Physik und Mathematik vorangegangen. Chamberlain hätte sich
durch die Lektüre des Buches davon überzeugen können und
meinetwegen auch daran freuen sollen. Und er hätte davon auch
151
etwas
lernen müssen. Ich will gleich sagen: was. Nach seinem Tode ist
ein Büchlein erschienen, das, lange vorher verfaßt, mir
gelegentlich von seiner ersten Frau mit dem Augenzwinkern der
Eingeweihten als ‚Houstons Lebenslehre‘ bezeichnet wurde, auf welche
die Welt gespannt sein dürfte und so weiter. In diesem
Büchlein, Gestalt und Leben,
fand ich,
als ich darin blätterte, die Idee, das Wort eines Gesetzes von der
Erhaltung der Gestalt ausgesprochen, in Analogie zum Gesetz von der
Erhaltung der Kraft, eine Idee, die mir ebenso falsch wie unsinnig
erscheint. Leben wir doch davon oder herrscht Leben in uns darum,
daß und weil es ein solches Gesetz weder gibt noch geben kann.
Wofür in Zahl und Gesicht
sozusagen der Beweis geliefert wird.
Völlig eingesehen habe ich vielleicht nie, was Chamberlain an
meiner Jugendproduktion so angezogen hat. Er meinte einmal zu mir,
meine Art erinnere ihn an die des Jules Laforgue,
mit dem er wenige Jahre vor dessen Tod freundschaftlich verkehrt haben
muß. Chamberlain war von äußerster Diskretion, und es
war nie ganz aus ihm herauszubekommen, wann, wo oder wie er seine mehr
oder weniger berühmten Freunde gekannt oder kennen gelernt hatte.
Eine gewisse Verwandtschaft zwischen meiner Art und jener des Jules
Laforgue mag wohl für Tod und
Maske geltend gemacht werden können. Chamberlain hatte eine
große Liebe für viele moderne Franzosen, so für Stéphane
Mallarmé, den er kannte, während er die moderne
deutsche Literatur nicht mochte, ja kaum beachtete. In Richard Wagner
waren für ihn alle Möglichkeiten des Modern-Poetischen
vorweggenommen. Was wollten andere Deutsche daneben? Chamberlain, der
nebenbei Französisch wie ein Franzose sprach und schrieb, liebte
die einzelnen Franzosen, die
152
Tatsache,
möchte ich sagen, des Franzosen. Beim Deutschen kam es ihm mehr
auf die Idee an; oft hatte man das Gefühl, daß er sich an
dieser Idee des Deutschen und vom Deutschen schadlos halte für
manches, was ihm der einzelne Deutsche vorenthielt.
Von 1902 an wurden Leseabende veranstaltet, zu denen außer mir
noch der spätere Botschafter in Moskau Ulrich
Graf von Brockdorff-Rantzau, damals Sekretär der Deutschen
Botschaft in Wien, und Hermann
von Keyserling, der jüngste von uns, damals noch in der
Geologie steckend, geladen waren. Leopold von Schroeder wurde wohl auch
zuweilen zugezogen und las einmal seine wenig glückliche
Übersetzung der Sakuntala vor. Chamberlain ‚sekretierte‘ ihn ein
wenig vor uns, ebenso wie er den deutschen Kaiser, nach einem Briefe an
diesen zu urteilen, vor uns, vor seinen ‚Freunden‘, ‚sekretierte‘. Was
gewiß aus Liebe und Bewunderung für beide geschehen sein
mochte und deren außerordentliche Stellung im Tempel der
Freundschaft bezeichnen sollte, aber doch auch ein wenig darum
betrieben wurde, weil der eine oder andere von uns Jüngeren hier
nicht ganz mit ihm fühlen konnte. Chamberlain liebte es, die
Freunde, soweit es anging, nicht oder nicht zu häufig zu mischen.
Ich habe oft bei ausgesprochenen Strebern beobachtet, daß sie
ihre Freunde auseinanderzuhalten suchen; bei Chamberlain aber, der
nichts vom Streber hatte, entsprang es einer sehr großen
Sensibilität. Er war im persönlichen Verkehr ebenso scheu und
zurückhaltend, wie er in seinen Büchern, vornehmlich in
Vorreden dazu, oder auch in Briefen aggressiv werden konnte.
An diesen Abenden war ich zumeist der Vorlesende: aus Stefan George,
aus Rilke, aus Kierkegaards
Buch des Richters und den Angriffen auf die Christenheit,
meiner
153
Übersetzung
des Gastmahls, sehr oft aus Tod und
Maske. Chamberlain las aus seinem Platobuch, daran er damals
schrieb, oft aber aus seinen geliebten Franzosen, Rousseau, Voltaire.
Mir fiel auf, wie er sich gegen alles Neue wie Kierkegaard oder die
großen Russen etwa sperrte. Sternes Tristram Shandy las er nach seinem
eigenen Geständnis alle Jahre einmal. Er war der erste, der mir
davon sprach.
Ich bin keinem bedeutenden Menschen begegnet mit größeren
Widersprüchen. Die meiner Meinung nach nicht auf ein eminent
Schöpferisches in Chamberlain weisen, auf welches er selber
niemals Anspruch erhoben hätte, sondern auf zweierlei
zurückgehen: auf die genannte sehr große Sensibilität
und auf die Tatsache, daß er sein ganzes Leben lang in der Fremde
gelebt hat und auch in England niemals zu Hause gewesen ist. Wenn
Widersprüche aus dem Schöpferischen kommen, so gebären
sie im Menschen die Imagination. Statt dieser war hier aber die
Sensibilität. Sie sprach unmittelbar aus dem Blick seiner
schönen Augen, aus der Gliederung des Gesichts- und
Schädelganzen mehr als aus den einzelnen Teilen des Gesichtes wie
Mund oder Nase, sprach aus der überaus zarten Schläfenpartie,
dem freien Nacken und noblen Schädelansatz. Ergebnis dieser
Sensibilität war eine enorme Kultur, vielleicht die
größte ihrer Zeit. Schädel und Gesicht erinnerten ein
wenig an das Gesicht und den Schädel Arthur
Balfours, der ebenso wie Chamberlain aus einem alten schottischen
Geschlecht kam, das in ein englisches hineingeheiratet hatte. Beide
übten eine große Faszination auf Menschen aus, auf Frauen
und Männer, eine Art sittlicher Faszination; nur ging sie bei
Chamberlain in gleichem Maße vom Werk und von der
Persönlichkeit aus, während sie sich bei
154
Arthur
Balfour ganz und gar auf letztere beschränkte, wo sie freilich
einen höchsten Grad erreicht hat, einen so hohen zum mindesten,
daß er es sich ohne weiteres gestatten durfte, das zäheste
und langweiligste Buch seines Jahrhunderts zu schreiben. Ich habe nur
einmal mit dem bedeutenden und viel bewunderten Mann ein langes
Gespräch führen dürfen, und zwar ausschließlich
über englische Lyrik, was wohl nur mit einem englischen Staatsmann
möglich ist.
Chamberlain konnte leicht ins Weinen geraten über Dinge, die ihn
angingen, ihm gefehlt haben im Leben. Er war nie wirklich ironisch,
gelegentlich aber nicht ohne eine gewisse Selbstgefälligkeit, die
seinem schwärmerischen, überschwenglichen Wesen einen
eigentümlichen Geruch verlieh. Darf man ihn einen Hypochonder
nennen, oder entsprang seine dauernde Sorge um die Gesundheit nicht
auch der Sensibilität, die ihrerseits wiederum in
körperlichen Leiden ihre Wurzel hatte? Einmal kam ich abends zu
ihm. Seine Hauptmahlzeit war zur Zeit das Abendessen. So etwas
wechselte bei ihm, eine Zeit lang war es aus
Gesundheitsrücksichten das Mittagessen gewesen. Er schnitt
übrigens nach alter englischer Sitte das Fleisch selber vor. Als
ich ihn nach der Ursache seiner strahlenden Laune und seines guten
Aussehens fragte, meinte er, weiter strahlend, er habe heute nachmittag
den Arzt bei sich gehabt, der habe ihn zwei ganze Stunden lang
untersucht und nichts gefunden. Sein Bruder Basil,
Professor an der Tokioter Universität, die köstlichste
Mischung von Gelehrtentum und Weltvornehmheit, die ich im Leben
angetroffen habe, sagte mir einmal, seinen trockenen Greisenfinger auf
einen imaginären Punkt in der Luft setzend: Auf einer ganz kleinen
Insel mit einem winzig kleinen Hotel darauf im Stillen Ozean
155
genau
in der Mitte zwischen San Franzisko und Tokio finde ich die Luft, die
mir zuträglich ist, und fühle ich mich vier Wochen lang in
jedem Jahre wirklich wohl.
Es ist gefährlich, bei Chamberlains umfassendem Wissen, die
verschiedensten Dinge betreffend, noch von Dilettantismus zu reden, wie
das von seiten der Gelehrten geschah. Sein Dilettantismus war, soweit
davon geredet werden kann, englisch, er war wörtlich zu nehmen und
lag in einem Sich-Delektieren an den Dingen des Wissens. Für
meinen Geschmack und für mein Gefühl machte er sich zuviel
aus dem Urteil von Gelehrten wie Harnack und
anderen. Bei Tisch in Liebenberg erklärte Harnack, daß
Rousseau und Voltaire als die wahren Repräsentanten des 18.
Jahrhunderts übrig bleiben würden und daß alles, was in
Kant steht, von Plato besser und schöner gesagt worden sei. Ich
könnte mir vorstellen, daß ich auf eine solche Flachheit
vielleicht ein ganzes Leben lang nicht mehr viel zu erwidern gehabt
hätte, weil ich dem Verkünder derselben von nun an
ausgewichen wäre. Chamberlain durchschaute die Menschen nicht. Und
zwar nicht aus Kindlichkeit, sondern wiederum aus Sensibilität,
aus einem gewissen Gefühl für Schutz. Und, was ganz und gar
englisch ist, aus einem natürlichen Machtbewußtsein. Der
Engländer braucht gar nicht erst ‚Psychologe‘ zu sein, ihm
genügt der Takt, um so viel von den Menschen zu wissen, als er
braucht, damit er die Menschen beherrsche. Chamberlain war Antisemit
und widmete seine Grundlagen
des 19.
Jahrhunderts einem der Rasse nach reinen Juden. Er sprach den Juden
das Genie, die Fähigkeit ab, genial zu schaffen, und nannte Weininger, den
Verfasser von Geschlecht und
Charakter, ein Genie, nur weil dieser den Juden erst recht, mit
einer gewissen Verzweiflung, das
156
Genie
abgesprochen hatte und, selber ein Jude, Antisemit war. Weininger hatte
mich einigemal, noch vor der Veröffentlichung seines berühmt
gewordenen Buches, besucht. Ich bin im Leben keinem gleich begabten,
gleich vielseitig begabten Menschen begegnet, der zugleich so wenig das
gewesen wäre, was man Persönlichkeit nennt, der so wenig
Faszination und Macht ausgeströmt hätte wie er. Weininger
hatte das Aussehen und Gebaren eines tief beunruhigten jungen Mannes
aus der Handelswelt, wenn sich das so sagen läßt. Und darum
schoß er sich die Kugel durch den Kopf. Im Sterbehaus Beethovens.
Chamberlain sah und fühlte so etwas nicht. Er stellte das eine Mal
die Idee über die Persönlichkeit und dann wiederum die
Persönlichkeit über alles, und doch kommt es auf die richtige
Erkenntnis der Beziehung beider zueinander an, wenn man nicht immer
ausgleiten oder sich als Schwärmer erweisen will. Auf Chamberlains
Seele lag in Augenblicken etwas von Schwärmerei, von der
Schwärmerei Wagnerscher Musik. Schwärmerei muß
offensichtlich in uns das Verhältnis zwischen Idee und
Persönlichkeit stören. In wie vielen Fällen ist sie
nicht mehr als das Verdampfen des Eigensinns. Als ich Chamberlain zum
ersten Mal besuchte, hatte ich als Katholik ein wenig Angst vor ihm,
geschah es doch um eben diese Zeit, daß er sich in den heftigsten
Angriffen gegen das Katholische, gegen die Jesuiten schriftlich
auslebte. Wie mußte ich nicht überrascht sein, da er mir
sehr bald gestand, die einzigen Priester, mit denen sich reden
ließe, wären die katholischen. Er mochte das Slawische
nicht, nahm heftig Partei gegen die Tschechen und Polen des alten
Österreichs, hörte weg, wenn einer Dostojewski vorbrachte,
bewahrte aber das ganze Leben lang, wie auch aus seiner Briefen
hervorgeht, eine Schwärmerei für die Serben,
157
er
— man denke! —‚ drei Wochen lang in Bosnien reisend, sich dort als
Reisender überaus wohlgefühlt hatte. Seine Liebe zum
deutschen Wesen war englisch, nichts war so englisch an ihm, darum
mußte sie von selbst in Schwärmerei übergehen,
überlaufen.
Der Blick seiner Augen war, sagte ich, sehr schön und doch der
Blick eines Ohrmenschen. Damit möchte ich physiognomisch das
Schwärmerische seines Wesens ausgedrückt haben. Er liebte
Augenmenschen, liebte den An-Schauenden, wie Goethe einer war, und war
selbst eigentlich kein Anschauender. Ob alle Schwärmerei zuletzt
nicht doch mehr vom Ohr her kommt? Vom Ohr her sich ins Auge
verschlägt, sooft sie dort aufleuchtet? Ich habe vorhin den Grafen
Ulrich von Brockdorff-Rantzau erwähnt als einen der wenigen
ständigen Teilnehmer an unseren Leseabenden, und ich will, da sein
Name für alle Zeiten mit der Weigerung verbunden bleiben wird, den
Vertrag von Versailles zu unterzeichnen, das über ihn sagen, was
mir damals an ihm und für ihn bedeutsam und wesentlich erschienen
ist. Wobei ich gleich hinzufüge, daß uns später der
Zufall nicht mehr zusammengeführt hat. Eines Abends, als er mich
im unnumerierten, von zwei Rappen gezogenen Fiaker eines Kollegen an
der Botschaft zu Chamberlain nach der Blümelgasse abholte, sagte
er während der Fahrt, sich in den Fond zurücklehnend und mich
mit seinem zugleich schwelenden und scharfen Blick fixierend: Es gibt
auf der Welt nur noch einen Menschen, der ehrgeiziger ist als ich, und
das ist mein Bruder. (Den ich nicht kannte und der ihm so ähnlich
gesehen haben soll, daß beide von Freunden auf der Straße
oft verwechselt wurden.) Dieses Geständnis war meinerseits durch
keine bestimmte Äußerung irgendwelcher Art hervorgerufen
worden, kam durchaus
158
unvermittelt,
so daß ich verlegen wurde. Zu erwidern war nichts, und mir fiel
nur, und zwar im Augenblick, Mime ein, der Siegfried in einer Szene von
großer Genialität des Dichterischen, ihm den Sud hinhaltend,
übereifrig gesteht, daß er ihm den Kopf abhauen werde...
Das war damals und ist auch heute noch, wenn auch seltener, so eine
Redensart, sooft das Gespräch auf einen sehr ehrgeizigen Menschen
kam oder kommt: dieser gehe über Leichen. Rantzau ging nun nicht
über Leichen, was immer sonst Kollegen über ihn gesagt haben
mochten, er war nämlich dazu ein viel zu komplexes Wesen,
nervös, fast ein Neurastheniker, voller Verdrängung. So ein
Neurastheniker geht vielleicht über Leichen, die ein anderer vor
ihn hingelegt hat... Rantzau war in der Tat eines der komplexesten
Wesen, die mir im Leben begegnet sind: boshaft, zynisch, schlagfertig,
anhänglich, auch gütig, nicht ohne ein gewisses
Schwärmerisches, merkwürdig unsicher und plötzlich
hochfahrend. Er hielt seine Familie für ‚hundertmal vornehmer‘ als
die Schwarzenbergs
— die im alten Wien immer als der Gradmesser des Vornehmen zu gelten
pflegten, die Liechtensteins
waren als Regierende wiederum zu vornehm für die Funktion des
Gradmessers —‚ und doch mußte es ihm passieren, daß er sich
in seiner ersten Ministerrede in Weimar vor den Abgeordneten der
Nationalversammlung dafür entschuldigte, daß er Graf sei.
Was aber damals im Fiaker mein Staunen erregte, war die Form des
Ehrgeizes. Mimes Ehrgeiz ist nämlich deutsch, ist die deutsche
Form des Ehrgeizes, ist ein Ehrgeiz, der durchsickert, die Form
sprengt, den Träger desselben preisgibt und ihm selbst darum oft
schädlicher ist als dem Rivalen oder Nächsten. Der Deutsche
hat keine Tragödie des Ehrgeizes wie Macbeth. Schillers Wallenstein
159
ist
der Versuch einer Philosophie des Ehrgeizes in Versen. Was alles an
einer mehr oder weniger deutlichen Zwiespältigkeit von Kopf und
Herz, Geistigem und Sinnlichem, Menschlichem und Nationalem liegt,
wobei eines
zu kurz kommen muß oder nicht zu reiner Wirkung gelangen kann:
das Leidenschaftliche.
An einem der großen Feste des Adels in Wien vor dem Kriege sah
ich da einen russischen Botschaftsrat durch die Säle schreiten und
mit den Blicken nach solchen sehen, die jetzt und hier wichtig
wären, wichtiger als andere. Er dachte vielleicht nicht so sehr
daran, mit ihnen in ein Gespräch zu kommen oder von ihnen in ein
Gespräch gezogen zu werden, darauf kam es letztlich jetzt nicht
an, das war bei so viel Glanz und Hoheit nicht entscheidend, nein, er
wollte nur dagewesen, er wollte gesehen worden sein von jenen, die im
höchsten Sinn jetzt da sind und einen bemerken. Das wollte er, und
das war auch das Entscheidende; alles andere versteht sich einstweilen
von selbst und wird auch immer wieder von neuem vergessen, wie in der
großen Welt so vieles sich von selbst versteht und so vieles
wieder vergessen wird. Und davon lebt, gespenstisch lebt, daß es
vergessen wird. Was also jetzt durch die erleuchteten Säle im
Frack mit dem Ordensband über der weißen Hemdbrust schritt,
spähend und geblendet, das war kein Mensch. Ein Mensch ließe
sich wohl unterbrechen oder durch ein Gespräch ablenken oder gar
in einen Winkel locken, nein, das war ein Wolf. Oder ein Mensch mit der
Maske eines Wolfes oder ein Wolf in der Maske eines Menschen.¹
¹ Man denke nach über den Zusammenhang der
Maske mit den einzelnen Leidenschaften. Soweit Leidenschaften
auseinandergehalten werden können und trennbar sind, tragen wir
Masken. Das deutsche Gesicht eignet sich am wenigsten zur Maske.
160
13
Allem Anschein nach hat das ‚Interessante‘, oder was so genannt wird,
an Wichtigkeit und Bedeutung unter den Menschen verloren. Und zwar seit
dem Weltkrieg, seit der Herrschaft des Menschen über die Luft, wie
das Fliegen genannt wird, seit dem Radio und manchem anderen. Was kann
schließlich noch ‚interessant‘ sein im Sinne des Menschen der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wenn heute irgendein Mensch
ohne die geringste Schwierigkeit mittels einer dem Aussehen nach
einfachen Apparatur instand gesetzt ist, jeden Tag dem Dalai-Lama bis
nach Lhassa guten Morgen zu wünschen? Nichts ist daneben
‚interessant‘. Außer vielleicht das ganz Banale. Dann ist zu
erwägen, daß der Kollektivmensch, der nun einmal da ist,
weder das Wort ‚interessant‘ gebraucht noch den Begriff hat. Sehr
große Rekorde im Sport, enorme Geschwindigkeiten, Flüge rund
um die Erde und ähnliches fallen nicht mehr unter die Rubrik des
Interessanten und müssen anders gekennzeichnet werden. Man
würde wahrscheinlich einen Champion beleidigen, wenn man ihn oder
seine Errungenschaften für interessant erklärte. Wettbewerb
welcher Art immer vermag keinesfalls die Sphäre des Interessanten
zu erweitern oder zu bestimmen. Singularität gehört dazu,
Schauspielertum. Die Schauspieler galten früher für
interessant. Auf alle Fälle, was immer sie auch angestellt haben
mochten. Es sieht so aus, wie wenn das Interessante und das Sachliche
im Widerspruch miteinander stünden, wie wenn ein Mensch entweder
das eine oder das andere sein müßte und niemals beides
zugleich.
Endlich kann das Interessante ohne das Gewöhnliche nicht bestehen.
Gleichwie im typischen Schauspielergesicht stets beides zusammen
anzutreffen ist. Es gibt,
161
um
genau zu sein, zweierlei Gewöhnliches: Erstens das
Gewöhnliche an sich ohne das Interessante. Das ist einer der
Aspekte des Teuflischen. Und dann das Gewöhnliche als Hintergrund
des Interessanten, was dann ganz und gar unteuflisch ist. Beiden, dem
Interessanten und dem Gewöhnlichen, fehlt: Wirklichkeit. Es ist
auch so, wie wenn beide nur halb da wären, gleichwie der Mond
immer nur zur Hälfte beleuchtet ist. Der Vergleich mit dem Mond
kann ausgedehnt werden: das Interessante leuchtet ebenso wie der Mond
mit geborgtem Licht. Daher dann der Mangel an Wirklichkeit,
Ursprünglichkeit, an Drama, an dem, was ich das Ungebrochene, die
Ganzheit alles Dramatischen, aller Handlung nennen will. Ich habe das
Interessante an sich darum nie recht gemocht, besser: gar nicht
bemerkt, davon weggesehen. Es schien mir verdächtig, schon von
früh an, und es kam mir immer nur so lange interessant vor, als
man es nicht zu Gesicht bekam. Von dem Augenblick an war es weg oder
verschwand im Gewöhnlichen.
In der Welt des Kindes ist alles oder nichts interessant. Und so soll
es sein. Insofern kann der Mensch sich dauernd nach dem Kind richten.
In unsere Kinderwelt im mährischen Dorf, in diese Kinderwelt
ohnegleichen, brach einmal ein veritabler Graf ein. Aus der Hauptstadt,
aus Wien. Er sollte bei uns die Landwirtschaft lernen, ‚volontieren‘,
wie das genannt wurde, bevor er die Verwaltung der eigenen Güter
antrat. Der war nun interessant, jeder Einzelzug war bei ihm
interessant, er bestand eigentlich nur aus solchen interessanten
Einzelzügen. Bei den Menschen, den älteren, gereiften, aus
der ganzen Umgebung. Er war aber nicht ‚interessant‘ für einen
jüngeren Bruder. Sooft nämlich der Graf in unseren Garten
kam, was selten geschah, und sich auf die
162
Bank
vor die Turngeräte setzte, das Kinn auf den Griff seines
schönen Stockes gestützt, hing mein Bruder schon am Reck oder
Barren oder auf der Strickleiter und fing an sich zu produzieren. Er
hatte das Gefühl, nur so, mit seinem Außerordentlichen, mit
dessen Vorführung, das Außerordentliche des Grafen aller
Grafen, des ganzen Grafentums reagieren, darauf antworten zu
können. Da gab es keine Einzelzüge, keine Gebrochenheiten.
Meist war der Graf, der kaum hingesehen hatte, schon weg, als mein
Bruder noch immer in oder an den Geräten hing. Mir wiederum, der
ich damals kaum mehr als sieben Jahre gezählt haben mochte, fiel
auf, wie der Graf auf die allereleganteste Art mit seinem schönen
Stock die Kuhstalltür zu öffnen verstand, um sich die
Hände nicht an der Klinke zu beschmutzen. Ich wartete schon immer
darauf, bis er wieder, mit ein paar Sätzen seiner langen Beine die
Straße nehmend, vor der Kuhstalltür stünde, um sie auf
seine unvergleichliche Art zu öffnen. Es würde nun keinen
Sinn gehabt haben, einen meiner Brüder oder meinen Jugendfreund
und Spielgenossen auf so etwas aufmerksam zu machen. Diese Produktion
war nur für mich da, und ich wartete, wie gesagt, schon darauf.
Fühlte auch, daß so etwas nicht nachzumachen wäre oder
wie alles Nachahmenswerte gerühmt und besprochen werden sollte.
Die überaus wundervolle und zugleich so selbstverständlich
gräfliche Aktion würde dann in zwei Teile zerfallen,
würde gebrochen werden: in das Originale und in das Nachgemachte.
Und das mußte vermieden werden. Wenn ich nicht dieses Gefühl
gehabt hätte, würde ich sicherlich meine Brüder um mich
herum versammelt und gerufen haben: ‚Kommt und seht, wie der Graf jetzt
wieder die Kuhstalltür öffnen wird mit dem schönen
Stock! Das kann nur er.‘ Ich sagte nichts, und so war,
163
was
geschah, viel mehr als bloß interessant. Nein, das Interessante
soll es nicht geben, denn wo das Interessante ist, dort hält sich
nicht weit davon das Vulgäre auf.
Die Menschen wollen, wenn das Gespräch darauf kommt, immer noch
etwas aus Rilkes Leben wissen, ein interessantes Detail. Ich hätte
ihn gut gekannt, auch hingesehen, also müsse es da doch noch etwas
geben. Die Menschen wollen hier das Interessante wissen nicht um des
Gewöhnlichen, sondern um des Geschwollenen willen, das in der Rede
über Rilkes Lebensanschauung, Gottesbeziehung, Glauben und so
weiter im Schwange und in Büchern über ihn zu lesen ist.
Wobei das Geschwollene nur die Umkehrung des Gewöhnlichen ist. In
diesem und in jedem anderen Falle auch.
Ich habe Rilke als Ganzes empfunden, weil er ein Ganzes war und nichts
bei ihm abfiel und irgendwo liegen blieb. Alles stimmte: das Kleine mit
dem Großen, das Alltägliche mit dem Außerordentlichen.
Kleine Züge an ihm, über die man lacht oder sich ärgert?
Daß er im Sommer weiße Gamaschen aus Leinen trug?
Darüber haben sich einige geärgert, denn ein Dichter
trägt keine weißen Gamaschen. Oder zum Smoking abends statt
der ausgeschnittenen Weste eine hochgeschlossene aus Sammet oder Seide?
Es war leicht einzusehen, daß er damit, mit so einer
priesterlichen Weste, darüber das russische Kreuz hing, die
Weltlichkeit des Smokings einigermaßen aufheben oder auch ein
wenig herabsetzen und seinem Aussehen etwas Priesterliches verleihen
Wollte. Auch das fanden die Leute zugleich interessant und doch auch
ein wenig ärgerlich. Das geht im übrigen sehr gut zusammen,
daß einer fort und fort auf das Interessante aus ist und sich
dabei über alles Erdenkliche ärgert. Eines Abends erschien
Rilke in Gesellschaft einer
164
Dame
in der Odeonbar in München und hatte eine gewöhnliche, eine
ausgeschnittene Weste zum Smoking. Wie alle anderen Menschen. Die Zeit
der hochgeschlossenen aus Sammet oder Seide war offenbar abgelaufen.
Ich lachte zu ihm an seinen Tisch hinüber, und er verstand gleich
mein Lachen, nahm es auf und gab es mir zurück. Er lachte, wie ein
kleiner Junge lacht, sein Gesicht war mit Lachen wie übergossen.
Ein anderes Detail aus seinem privaten oder auch gewöhnlichen
Leben wäre, daß er eine so wundervolle Art hatte, Trinkgeld
zu geben. Er gab im Verhältnis zu seinen Mitteln zuviel, denn in
diesem Zuviel schien ihm der Sinn des Trinkgeldgebens zu liegen. Und
das Trinkgeld war für ihn ganz und gar nicht die Regelung einer
Angelegenheit zwischen zwei Persönlichkeiten, einer dienenden und
einer, die bedient wird. Es hatte auch seiner Ansicht nach nichts
dergleichen zu sein. Ich weiß einen weltberühmten Gelehrten,
der, sooft er wo zu Gast ist, sich beim Abschied in die Küche
begibt, um sich bei der Köchin für alles Genossene und die
Mühe, die sie damit hatte, zu bedanken. Das ist alles, und das ist
sehr verschieden von der Art Rilkes, sich zu solchen Dingen zu stellen.
Was mich auf einen kleinen Zug bringt, aus welchem, wie ich ahne, gar
viel für sein Großes gewonnen werden könnte, wenn wir
dazusehen. Er verstand es, Geschenke zu machen wie nicht leicht ein
anderer. Was er schenkte, war sozusagen immer das Richtige, und so
eines von seinen Geschenken blieb auch das ganze Leben lang ein
Geschenk und wurde nicht mit der Zeit zu etwas, das herumliegt und im
Wege ist. Etwas Brauchbares im gewöhnlichen Sinne, etwas
Nützliches sollte es eben nicht sein. Er protestierte einmal
heftig, als ich ihm Kiebitzeier, einen ganzen schön geflochtenen
Korb damit, wie er
165
sich
in der Auslage unseren Blicken verlockend anbot, zum Geschenk machen
wollte. Nein, so etwas: zum Essen, etwas Nützliches, wollte er von
mir nicht haben; dazu wären andere da. Es war während des
Krieges in München, alle Menschen litten mehr oder weniger Hunger,
und da dachte ich mir, ein immerhin Seltenes wie Kiebitzeier könne
man doch Rilke gegenüber riskieren, Kiebitzeier seien
schließlich doch etwas Besseres und von höherem Rang als ein
Schinken oder ein Hase. Doch an seiner Abwehr erkannte ich gleich,
Kiebitzeier seien es auch nicht trotz Hunger und Krieg.
Wahrscheinlich ist ihm dabei das eine aufgegangen, daß ich das
überhaupt nicht recht verstünde: Geschenke machen, daß
ich sehr leicht, wenn ich mich so ausdrücken darf, vorbeischenke,
und daß es darum meist ganz unwichtig sei, ob ich schenke oder
nicht schenke. Wir haben uns darüber nie unterhalten, obwohl es so
recht ein Thema für eine unserer Konversationen gewesen wäre.
Seine Art und meine Art, sein Vermögen und mein Unvermögen
sind zwei verschiedene Arten der Seele oder des inneren, des
verborgenen Menschen, sich auszudrücken, zwei verschiedene Arten
des Schicksalhaften, und müssen als das hingenommen werden. Die
seine weiß ich im Geiste mit seiner großen Artikuliertheit,
mit einer sehr offenbaren Überreife des ganzen Wesens zu
verbinden, die sich zudem physiognomisch so deutlich im Gesicht
ausdrückte, im Munde, der vor Überreife geplatzt zu sein
schien wie eine große Pflaume. Ferner mit seiner
Entschlossenheit, Ordnung zu halten und seine eigenen Dispositionen
sehr ernst zu nehmen. Es ist nämlich ganz falsch, zu meinen,
daß Rilke unpraktisch gewesen sei, hilflos in den Dingen des
täglichen Lebens oder je am halben Weg stehen geblieben wäre.
Im Herbst
166
1910
stiegen wir beide im gleichen Hotel in Paris ab am linken Ufer. Am
nächsten Tag morgens, als ich mich nach ihm umsehen wollte, war er
schon ausgezogen, denn die Hotelleute müßten, wie er meinte,
ihr Metier erst lernen, während ich sechs Wochen blieb und den
Schrecken, den mir die Inkompetenz der Hotelleute einjagte, jenem
anderen vor dem Einpacken, Ausziehen und erneuten Suchen vorzog. Das
sind also solche Details aus dem Leben Rilkes, den heute der
größte Ruhm kleidet, kleine Züge, wie die Menschen sie
zu hören lieben und die vielleicht nur ich bemerkt habe.
Jetzt will ich aber etwas anderes tun, und zwar den chinesischen
Drachen der Deutungskunst und Einbildungskraft so hoch steigen lassen,
als es geht, und das von oben ansehen, was unten liegt und unten liegen
bleiben soll: ich meine eben die Details und kleinen Züge. Unsere
Einbildungskraft ist in der Tat so ein weißer, weißblauer
Drachen, wie ihn die Kinder überall an hellen Frühlingstagen
in die azurene Luft steigen lassen, ein Ding, ganz Aufflug und Sinken,
ohne Herz, ohne Nieren, ohne Eingeweide, ein Ding, da, um flatternd und
fliegend den Abstand zu messen zwischen Unten und Oben. Vom
chinesischen Kaiser heißt es, daß er auf einem Drachen,
einem goldenen, auffährt in den Himmel. Ist ein solcher Drachen
nicht darum des Kaisers Wappentier, das Wappentier aller Menschen, die
dem Kaiser in den Himmel nachfolgen wollen? Und ist dieses Wappentier
darum nicht unbeweglich und festgemacht an den Dingen unten: als ein
Wahrzeichen vom Himmel her? Einmal aber war es beweglich gewesen,
flatterhaft und emporschießend gleich den weißen
Papierdrachen der Kinder und der Phantasie derer, die zum Dichten und
Deuten auserwählt, die da sind, um die
167
Spanne
und den Weg fliegend zu messen zwischen Unten und Oben.
Was sehen wir also von oben? Wie das von oben, was unten ist: Rilkes
schöne Gabe, Geschenke zu machen? Und zu empfangen? Denn beides
gehört zusammen: das Geben und das Empfangen. Das und so: Für
ihn war der Mensch unter allen Bedingungen Liebender oder Geliebter,
Liebender und Geliebter, für ihn bestand die Menschheit daraus.
Die Welt war wie verteilt unter Liebende und Geliebte. Das war sie in
der Tat, und so lohnte es sich, sie zu sehen. Das Geschenk aber, die
Gabe, die vom einen zum anderen ging, war Reigen und Brücke, war
Spiel zwischen ihnen, zwischen den Liebenden und den Geliebten. Daher
also die hohe Bedeutung der Gaben und Geschenke. Was wir Freiheit
nennen, ist das dann etwas anderes als der Raum, darin die Gaben vom
einen zum anderen gehen?
Die Welt ist aber nicht nur in Liebende und Geliebte, sondern auch in
Lebende und Tote eingeteilt, sie ist zwischen den letzteren so
ausgewogen, daß sich sagen läßt, das Gewicht der Toten
sei genau so groß wie das der Lebenden.
Ist das richtig? Rilke wollte es jedenfalls in seinen Duineser Elegien als seine Lehre so
hinstellen. In der Tat gilt oder stimmt es nur für die Seelenwelt.
Und Rilkes Welt war, vielmehr ist Seelenwelt. Aus welcher er nicht
herausgeschritten ist oder herausschreiten konnte. Darum ist der Vers
für ihn das Primäre, die gegebene Sprache und strebt auch
seine Prosa nach dem Vers, besser: ist seine Prosa dem Vers verfallen.
Ich habe sehr lange nach der höchsten und letzten Deutung, nach
dem letzten Sinn des Verses an sich im Geiste geforscht, und ich
glaube, ihn jetzt gefunden zu haben: Er ist eben in seinem letzten Sinn
die Sprache jener Welt, die geteilt
168
ist
zwischen Liebenden und Geliebten, Lebenden und Toten und von da allein
ihr Gleichgewicht und ihre Freiheit hat. Was sich bis in die kleinsten
Details der Verskunst und Verslehre, ins Künstliche derselben
verfolgen ließ. Ich könnte von hier von neuem, aus einer
anderen Gegend, den Weg finden zu Rilkes Mißverständnis oder
Nichtverstehen des Sohnes, denn die Seelenwelt, die pure, ist die Welt
des Vaters, in welcher allein Rilke zu leben und leben zu können
meinte.
Meine Welt ist primär die des Geistes, und ich habe von ihr erst
den Zugang in die Seelenwelt finden können. Die Welt des Geistes
mit dem Übergewicht des einen über das andere: ebensosehr,
heißt das, der Lebenden über die Toten wie der Toten
über die Lebenden, denn darauf kommt es in der Tat an: auf dieses
Übersteigen des einen über das andere, auf ein
Überhandnehmen des einen durch das andere. In der Welt des Geistes
ist die Lehre der Elegien vom
Gleichgewicht zwischen den Lebenden und den Toten, zwischen denen im
Licht und denen im Dunkel, falsch. So ist die Welt des Geistes. Nur aus
dem, was ich das Übergewicht des einen über das andere nenne,
aus dem Übersteigen, Überhandnehmen ist schließlich die
Welt der Ideen als solche einzusehen, die Welt der Scheidung von Mensch
und Idee, von Oben und Unten, die Welt endlich des Einen und Einzelnen
so wie ich den Einzelnen verstehe: in dessen Beziehung zum Unendlichen.
Der Ausdruck davon ist die Prosa, und zwar die Prosa in ihrer
Einzigkeit und auf ihrer höchsten Stufe. Die deshalb darin ihren
letzten Sinn findet, daß sich die Welt nicht entzwei- und
verteilen läßt: in Liebende und Geliebte, in die Lebenden
und die Toten, gleich wie der Mond geteilt ist in eine belichtete und
unbelichtete Hälfte.
169
Die
Alten haben im Dialektischen das Innerste und Eigentliche der Prosa
erblickt. Der moderne Mensch von heute ist dem Dialektischen
gegenüber mißtrauisch und zieht in der Not das Lyrische vor.
Ich habe im Umgang des Jahres
das Dialektische für uns heute zu bestimmen und irgendwie
brauchbar zu machen versucht, was ich nicht unerwähnt lassen darf.
Doch geht es bei uns zum Unterschied von den Alten mehr um
Persönlichkeit als um Bestimmung des Begrifflichen. Drei Menschen,
drei Geister hatten jene Prosa sich zu eigen gemacht, die den Vers
ausschließt: Blaise Pascal, Lawrence Sterne und Sören
Kierkegaard. In allen dreien erkenne und verehre ich meine hohen Ahnen.
In der achten Duineser Elegie, über die Rilke meinen Namen
geschrieben hat, wendet er sich auf seine lyrische Art gegen meine Idee
von der Umkehr, wie er dieser in den Elementen
der menschlichen Größe begegnet ist. Rilke wendet
sich dagegen, weil er es nicht wahrhat, daß diese Umkehr nur in
der Geisteswelt, in der meinetwegen dialektischen Welt des Einen und
Einzelnen und nicht in seiner der Liebenden und der Geliebten vor sich
gehen kann. Diesen Einen und Einzelnen jener Welt der Umkehr, der Welt
des Sohnes, den im letzten, tiefsten und einzigen Sinne
Freiheitschaffenden, sah Rilke nicht, gegen den wehrte er sich und an
den glaubte er auch nicht. Daher steht dann bei ihm statt der Umkehr
etwas anderes: eine sehr merkwürdige, eine oft unheimliche
Mischung von Kindlichkeit und Perversion. Aus welcher wiederum, aus
welcher allein seine Beziehung zur Psychoanalyse und zu dessen
Begründer eingesehen werden kann. Rilke ist dazu ganz
allmählich geführt worden. In seiner Vaterwelt. Der Weg war
eine Sackgasse. Ich bin den Weg in der entgegengesetzten Richtung
gegangen, weil ich um keinen Preis in eine Sackgasse geraten wollte.
Letzte Änderung: 7. Juni 2020